Lerchenfeld #53: Von Mäusen und Menschen
Im vergangenen Jahr hat die HFBK Hamburg eine groß angelegte Befragung ihrer Absolvent*innen vorgenommen. Im Mittelpunkt standen Fragen nach der aktuellen Lebens- und Arbeitssituation. Die Ergebnisse sind aufschlussreich – vor allem im Bezug zum Kunstmarkt
– Text von Astrid Mania
Seit nunmehr zwanzig Jahren vollzieht sich im März ein Ritual, das viele Teilnehmer*innen und Beobachter*innen des Kunstmarkts mit Spannung erwarten: die Veröffentlichung des Art Market Reports. Er verdeutlicht anhand von Zahlen, Tabellen und Grafiken, ob im Vergleich zum Vorjahr mehr oder weniger Kunst, Schmuck und Antiquitäten erworben wurden, von wem, bei wem und in welchen preislichen Dimensionen. Ursprünglich verfasste seine Autorin, die Ökonomin Clare McAndrew, ihn für die Maastrichter Kunst- und Antiquitätenmesse TEFAF. 2017 wurde McAndrew von der Art Basel abgeworben – nun erscheint der Report unter der sperrigen, sponsorenberücksichtigenden Bezeichnung Art Basel and UBS Global Art Market Report.[1] Mit der Länge des Namens wuchs auch sein Umfang: Der aktuelle Bericht, der auf das Geschäftsjahr 2019 schaut, umfasst gut 380 Seiten.[2]
Warum aber sollten wir uns an einer Kunsthochschule mit einer solchen Monstrosität befassen? Weil wir in dem kapitalistischen System, in dem wir leben und arbeiten – manchmal auch synonym zu verwenden – alle in den Kunstmarkt bzw. bestimmte Bereiche des Kunstmarkts eingebunden sind. Geht es beispielsweise den Galerien gut, geht es, idealerweise, auch den Künstler*innen gut.[3] Auch für die Lehre an einer Kunsthochschule ist zumeist ein gewisser Erfolg, der sich auch ökonomisch spiegelt, Voraussetzung. Dass „der Markt“ bei vielen dennoch reflexhafte Abwehrreaktionen hervorruft, liegt im Wesen einer Kunst nach westlich-kapitalistischem Muster. Pierre Bourdieu, Soziologe und Verfasser einsichtsreicher Reflexionen zu Kunst und ihren Märkten, diagnostiziert das Verschleiern der ökonomischen Interessen auf dem Gebiet der Kunst als die Folge ihrer Befreiung aus klerikalen und aristokratischen Auftraggeberverhältnissen: Die Künstler*innen mussten sich nach einer neuen Kundschaft umschauen und fanden sie in Gestalt der viel beschworenen und beschimpften Bourgeoisie. Damit entstand zugleich die Notwendigkeit, die Legitimation der Kunst neu zu denken, in ihr beispielsweise ein Instrument zur Kultivierung von Geist und Gesellschaft oder etwa den Ausdruck reinen Geistes zu sehen. In der Folge, so Bourdieu, lautete die Spielregel für den Kunstmarkt, dass man „nur tun[kann], was man tut, indem man so tut, als täte man es nicht.“[4]
Scheinen also die ökonomischen Interessen (an) der Kunst hervor, ist es, als sähe man das Koordinatengitter auf dem Holodeck der Enterprise: Beides ist unerwünscht. Womöglich erklärt die Tarnung vieler ökonomischer Transaktionen auch, warum sich nachweislich falsche Erzählungen über die angeblich am wirtschaftlichen Erfolg so desinteressierten Künstler der Moderne ebenso hartnäckig halten wie die Rede von der brotlosen Kunst. Natürlich sieht es einkommenstechnisch für freie Künstler*innen nicht gerade rosig aus, euphemistisch formuliert. In einer anschaulichen, noch farbenfroheren Grafik, die Die Welt in einem Artikel aus dem Jahr 2017 publizierte, zeigt sich, dass das durchschnittliche Jahreseinkommen für Maler bei 14.120 Euro lag, das der Malerinnen bei 9.773 Euro. Erstaunlicherweise – gilt die Malerei doch vor allem unter Galerist*innen als sichere Bank[5] – rangierte das gemittelte Jahreseinkommen von Performancekünstlern immer noch bei 10.521 Euro (ihre Kolleginnen kamen auf magere 7.943 Euro).[6] Entsprechend schätzte Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des deutschen Kulturrats, in besagtem Beitrag, dass fünf Jahre nach Ende des Studiums „fünf Prozent noch auf dem freien Markt aktiv“ seien.
Einen Prozentpunkt weniger attestierte bekanntlich das Symposium Überlebensrate 4% – Aktuelle Frontberichte aus der Kunstakademie an der HFBK. Angesichts dieser verheerenden Zahl ließ sein Organisator und Malerei-Professor Werner Büttner die Teilnehmer*innen des Symposiums die „Existenzberechtigung von Kunstakademien“, gemessen am „Lebenserfolg ihrer Absolventen“, wie es im Vorwort hieß, diskutieren – eine bewusst provokative Frage, die dennoch zeigt, wie sehr sich der Diskurs über Kunst und die Qualifikationen zu deren Ausübung in Richtung ökonomischer Quantifizierbarkeit verschoben hat und daran gekoppelt wird.[7]
Eine nicht-repräsentative und nicht-systematische Befragung unter ihren Absolvent*innen hat die HBK Braunschweig durchgeführt. Zwar sind die Befunde, auf die Annette Tietenberg in ihrem Essay referiert, damit nicht wissenschaftlich belastbar, doch deckt sich ihr Fazit so verblüffend mit dem der aktuellen Untersuchung hier am Haus, dass die Passage in voller Länge zitiert werden soll: „Befragungen an der HBK Braunschweig, so wenig verlässlich solche stets ideologisch eingefärbten politischen Instrumente auch sein mögen, haben ergeben, dass viele Absolvent*innen der freien Kunst tatsächlich in einen anderen Beruf eingemündet sind oder nebenbei jobben. Dennoch bekennen die meisten, ob im Feld der Kunst erfolgreich oder nicht, sie seien mit ihrer Lebenssituation zufrieden, obwohl sie, nach eigenen Angaben, unregelmäßige Einkünfte haben und generell weniger Geld verdienen als Gleichaltrige in anderen Berufen, also vermutlich eher — wie schon Bruce Nauman ahnte — von der Hand in den Mund leben. Viele sagen, dass sie, noch einmal vor die Entscheidung gestellt, ein Studium zu ergreifen, wieder Kunst studieren würden und nichts anderes. Die Aussicht darauf, die Fähigkeit zu erlangen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, wird offenbar höher geschätzt als das Versprechen von ungebremstem Konsum.“ (S. 60)
Dies ist auch das grobe Fazit der Umfrage, die im Oktober 2019 von Henning Lohmann und Sascha Peter von der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Fachbereich Sozialökonomie, an der Universität Hamburg unter Absolvent*innen der HFBK durchgeführt wurde.[8] Umfragen sollte man in der Tat mit einem gesunden Misstrauen begegnen. Gerade zeitaufwändigen Analysetools haftet oft das Vorurteil an, sie würden lediglich von „den Frustrierten“ genutzt, die hier ein Ventil für ihre Unzufriedenheit fänden. Dagegen spricht allerdings, dass die Mehrzahl der Befragten (immerhin rund ein Drittel der angeschriebenen Alumni hat teilgenommen) ihr Studium an der HFBK als „sehr hilfreich“ (38 %) bzw. „ziemlich hilfreich“ (44 %) für die Entwicklung der eigenen künstlerischen Persönlichkeit beschreiben. (S. 23 ff) Ein etwas anderes Bild ergibt sich bei der Frage nach der Relevanz des Studiums „für den Erwerb von Kenntnissen und Fähigkeiten, die die Befragten tatsächlich in ihren kunstnahen und kunstfernen Tätigkeiten nutzen“. Hier zeichnet sich im Ergebnis eine Pattsituation ab. Dennoch – eine überwältigende Mehrheit würde nach eigener Aussage wieder an der HFBK studieren: 18 % sagen, „ja, ganz sicher“, und 56 % „ja, wahrscheinlich“.
Wie sieht es nun konkret mit der wirtschaftlichen Situation ehemaliger HFBK-Studierender aus den freien Künsten aus? Und wie setzt sich ihr Einkommen zusammen? 18 % aller Befragten waren 2018 abhängig beschäftigt, 43 % selbständig, worunter künstlerische ebenso wie die sogenannten kunstnahen Tätigkeiten fallen. Bei 31 % stammte das Einkommen aus einer Kombination beider Erwerbsformen. Geschlechtsunterschiede sind hier nicht markant. Bei den Selbständigen machten die künstlerische Arbeit 44 % und kunstnahe Tätigkeiten 33 % des Einkommens aus, bei den hybrid Beschäftigten liegt das Verhältnis bei 22 % zu 33 %. Wer in abhängiger Beschäftigung stand, erreichte lediglich einen Einkommensanteil von 6 % durch künstlerische Praxis (alle Zahlen für 2018). Eine Tabelle, die die ausgeübten kunstnahen und kunstfernen Tätigkeiten näher spezifiziert, veranschaulicht, dass das Gros der HFBK-Absolvent*innen mit 16,4 % im Bereich „Lehrende und ausbildende Berufe“ zu finden ist – dabei wurden Lehramtsstudierende bei der Umfrage nicht berücksichtigt. Dieses Berufsfeld sorgt also auch im Bereich der freien Künste für ein ansatzweise solides Einkommen. 23,5 % der ausgeübten Tätigkeiten lagen im in sich sehr diversen Bereich der darstellenden und unterhaltenden Berufe; hier wiederum sticht die Kennziffer „Museumsberufe ohne Spezialisierung, Museums- & Ausstellungstechnik“ mit 7,1 % heraus. Eine weitere relativ hohe Prozentzahl findet sich erwartungsgemäß bei den „Berufen im Grafik-, Kommunikations- und Fotodesign“ mit 6,5 %; bei den kunstfernen Tätigkeiten kommen „Tourismus-, Hotel- und Gaststättenberufe“ insgesamt auf 9,9 %.
Die realen Einkommensverhältnisse sehen entsprechend aus. Den höchsten Prozentsatz (ca. 22 %, die Grafik ist in Fünferschritte unterteilt) machen Brutto-Einkommen bis jährlich 6.000 Euro aus (alle Zahlen für 2018), gefolgt von der Einkommensspanne 6.000 bis 12.000 Euro (ca. 16 %). Einkommen ab 30.000 Euro bis hin zu und über 96.000 Euro erzielten jeweils um die fünf bzw. deutlich weniger Prozent der Befragten. Die sogenannten Hybriderwerbstätigen erreichen dabei das höchste Einkommen, wobei nicht ersichtlich ist, durch welche Tätigkeiten genau sich dieses ergibt. Konkrete Zahlen gibt es zu den Einkünften aus künstlerischer Tätigkeit: Abhängig Beschäftigte erwirtschafteten durch ihre künstlerische Praxis ein durchschnittliches Einkommen in Höhe von 607 Euro, Selbständige 11.245 Euro und hybrid Erwerbstätige 6.125 Euro. Dies kommt den Befunden der Künstlersozialkasse bzw. des Bundesverbands Bildender Künstlerinnen und Künstler nahe.
Legt man die Anzahl der verkauften Arbeiten zugrunde, so muss man die Preise bei den Werken der HFBK-Absolventinnen im Durchschnitt wohl als ausgesprochen niedrig ansetzen. Im arithmetischen Mittel kamen die männlichen Absolventen auf 13,2 verkaufte künstlerische Arbeiten, weibliche auf 8,1 und sich als divers bezeichnende auf 6,8.[9] 44 % dieser Verkäufe resultierten laut Umfrage aus Selbstvermarktung, die nicht weiter spezifiziert ist. Die immer wieder kolportierten Erfolgsstorys von Künstler*innen, die über die sozialen Medien zu Ruhm und Geld gelangen, scheinen auf die Absolvent*innen der HFBK eine geringe Wirkung zu haben: Aus der gleichen Gruppe nutzen nur 6 % Instagram (11 % der Männer, 4 % der Frauen), 32 % haben eine eigene Internetpräsenz (29 % / 33 %), und 26 % aller Befragten (27 % / 24 %) sind weder auf Instagram aktiv, noch verfügen sie über eine eigene Webseite.
Eine Galerievertretung hatten 34 % der sich als männlich im Gegensatz zu 27 % der sich als weiblich definierenden Absolvent*innen. Das entspricht nicht den Befunden des aktuellen Art Market Reports. Im Durchschnitt, hier spielt die Dominanz der männlichen Künstler vor allem im Bereich der Klassischen Moderne und der Nachkriegskunst eine Rolle, sind mehr Künstler als Künstlerinnen in den Galerieprogrammen zu finden.[10] Anders sieht es global im Bereich der sogenannten Emerging Artists aus. Hier verzeichnet der Bericht einen Frauenanteil von 48 %. Vor diesem Hintergrund müssten eigentlich mehr Absolventinnen der HFBK eine Galerievertretung finden.
Die Mehrheit der Galerien, die ehemalige Studierende der HFBK repräsentieren, nimmt auch an Kunstmessen teil, so ein weiteres Ergebnis der Umfrage. Dies ist in Hinblick auf das ökonomische Wohlergehen von Künstler*innen insofern relevant, als dass 2019 immerhin 30 % der jährlichen Umsätze bei Galerien mit einem Geschäftsvolumen bis 500.000 US-Dollar auf Messen erzielt wurden, 34 % bei Galerien mit einem Jahresumsatz zwischen 500.000 und einer Million US-Dollar, wobei die Bedeutung von lokalen und internationalen Messen hier in etwa gleichauf ist, so der Art Market Report. Eigene stichprobenartige Nachfragen bei deutschen und österreichischen Galerien im Jahr 2016 ergaben, dass eine mittelständische Galerie für die Teilnahme etwa an der Art Basel mit Kosten in Höhe von über 100.000 Euro rechnen muss.[11] Die verdient man nicht mit junger, erschwinglicher Kunst. Diese wird denn auch eher auf regionalen Messen gehandelt. So zählen laut Report zu den auf deutschen Messen ausgestellten Künstler*innen im Zeitraum 2015 bis 2019 immerhin 21 % zu den Emerging Artists, wobei auch hier wieder der Anteil der Künstlerinnen bei nur einem Drittel liegt. Allerdings verfügt Deutschland nach der Selbstpulverisierung der Berliner Messe Art Berlin mit der Art Cologne und der Art Karlsruhe nur noch über zwei größere Veranstaltungen. Ob sich die besonders in Berlin im Fahrwasser der Hauptmesse segelnden Nebenmessen wie die Positions mit ihrem Angebot bis 50.000 Euro halten können, bleibt abzuwarten. Vielleicht ist es aber auch die große Chance für Messen, die auf Käuferschichten zielen, die in der allgemeinen Berichterstattung und damit im Bewusstsein vieler vor lauter Auktionsrekorden und Wahnsinnspreisen gar nicht mehr vorkommen. Man kann es daher nicht oft genug betonen: Es gibt bezahlbare spannende, wundervolle, beglückende Kunst.
Von Bedeutung sind auch die Standorte der Galerien, die Absolvent*innen der HFBK vertreten. An erster Stelle steht hier Hamburg (17), gefolgt von Städten außerhalb Deutschlands (14) und Berlin (12). Das spricht für ein erfreuliches Engagement des Hamburger Kunsthandels. Angesichts der oben genannten Kosten allein für große Messen, allen voran jedoch die laufenden Posten für Miete und Nebenkosten, Personal, Produktion von Kunstwerken und der eigene Lebensunterhalt, muss eine Galerie es sich buchstäblich leisten können, auf junge und im Verhältnis erschwingliche Kunst zu setzen. Je höher der Kostenapparat einer Galerie, umso höher müssen natürlich auch die Preise sein, die sie für ihre Künstler*innen bzw. deren Werke aufruft. Die deutschen Galerien setzten laut Art Market Report in den Jahren 2015 bis 2019 in ihrem Programm zu 47 % auf Emerging Artists. Und je höher der Umsatz einer Galerie, die im Primärmarkt agiert – also als direkte Mittlerin zwischen Künstler*in an Sammler*in auftritt – desto geringer der Anteil der Emerging Artists. Allerdings gibt es in Deutschland auch nur wenige Galerien, die international mit den Großen mithalten könnten. Im Gegenzug bedeuten junge Künstler*innen verhältnismäßig geringe Kosten etwa in der Produktion und einen überschaubaren Aufwand in der administrativen und logistischen Abwicklung ihrer Ausstellungsprojekte. Jedoch können kleinere Galerien häufig nicht mit dem wachsenden Erfolg ihrer Künstler*innen mithalten; letztere wechseln dann zu etablierteren, finanz- und personalstärkeren Händler*innen, und deren ökonomisch gesehen jüngere Kolleg*innen müssen Ausschau nach der nächsten vielversprechenden Position halten.
Gemessen an der Zahl der einzelnen Verkäufe, so der Art Market Report, führt der Bereich von künstlerischen Werken (und Antiquitäten bzw. Schmuck) bis 50.000 US-Dollar mit großem Abstand, jedoch ist dieses Preissegment nur noch für 27 % aller Umsätze verantwortlich. In früheren Jahren sorgte es mitunter für den Löwenanteil der Umsätze, was speziell für jüngere Künstler*innen keine ganz so gute Nachricht ist. Geraten die Galerien in den unteren Preisregionen unter Druck, wackelt das Fundament. Erschwerend kommt hinzu, dass die Politik in Deutschland sich bislang nicht gerade als kunstmarktfreundlich erwiesen hat – möglicherweise aus der oben skizzierten Aversion dem Kunstmarkt gegenüber. Während in anderen Ländern Galerien etwa Unterstützung bei der Teilnahme an Messen erhalten, weil sie als kulturelle Botschafterinnen verstanden werden, ist von solchen Maßnahmen hierzulande nichts bekannt. Dabei hatte der globale Kunstmarkt, so die Schätzungen des Art Market Report, im Vorjahr ein Gesamtvolumen von 64,1 Milliarden US-Dollar. Der Anteil Deutschlands am weltweiten Markt beträgt zwar nur klägliche zwei Prozent, das sind in der Summe aber immer noch 1,28 Milliarden US-Dollar.
Dr. Astrid Mania ist Professorin für Kunstkritik und Kunstgeschichte der Moderne. Außerdem schreibt sie regelmäßig für die Süddeutsche Zeitung über den Kunstmarkt.
[1] S. hierzu das Interview mit Clare McAndrew: Mania, Astrid: „Suche nach Sicherheit“, in: Süddeutsche Zeitung, Feuilleton/Kunstmarkt, 25./26. März 2017, S. 22 sowie als Auszug unter http://www.sueddeutsche.de/kultur/rueckblick-gute-preise-gute-besserung-1.3434957
[2] Wer hineinschauen möchte – bitte sehr: https://www.artbasel.com/news/art-market-report
[3] Die folgende Anmerkung steht nur deshalb unter den Fußnoten, damit der Fluss des Textes nicht leidet, sie ist keinesfalls nebensächlich: Tatsächlich kommt es häufiger vor, dass Galerien im Falle eines Verkaufes den Künstler*innenanteil nicht auszahlen, weil sie finanziell unglücklich verstrickt sind. Diskretes Umhören empfiehlt sich, ehe man sich auf die Geschäftsbeziehung mit einer Galerie einlässt.
[4] Bourdieu, Pierre: Kunst und Kultur. Zur Ökonomie symbolischer Güter,Schriften zur Kultursoziologie 4. Suhrkamp, Berlin 2014/2016, S. 98.
[5] In diesem an Zahlen und Umfragen nicht armen Text soll der Verweis auf die Galerienstudie 2013 des Instituts für Strategieentwicklung nicht fehlen, wonach 75% aller Verkäufe in deutschen Galerien über Werke der Malerei erzielt wurden.
[6] https://www.welt.de/wirtschaft/article171309538/Preisgekroent-und-trotzdem-nur-ein-Hungerlohn.html (letzter Zugriff 6. März 2020)
[7] Am 14. Juli 2017 im Rahmen ihrer 250-Jahr-Feier an der HFBK. Es mündete in die gleichnamige und im Gegensatz zur Behauptung ihres Titels überaus erfolgreiche Publikation: Sie ist vergriffen. Dankenswerterweise ist sie auf der Webseite der HFBK zum freien Download verfügbar: www.hfbk-hamburg.de/documents/497/Uberlebensrate_4_pdf.pdf
Die Zahl von 4% Überlebensrate basiert auf einer Befragung zur wirtschaftlichen und sozialen Situation Bildender Künstler*innen, die vom Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) im Jahr 2016 durchgeführt wurde. Walter Grasskamp relativierte diese Zahl in seinem Beitrag mit einem Verweis auf die anderen Berufsfelder jenseits der freien Kunst, für deren Ausbildung die Kunstakademien ebenfalls Sorge tragen. Vgl. Grasskamp, Walter: „Die Legitimität der Kunstakademie“, in: überlebensrate 4 %, aktuelle frontberichte aus der kunstakademie, Hamburg 2018, S. 27 – 49, 27f.
[8] Die Studie steht als pdf-Dokument auf der Website der HFBK Hamburg zum Download zur Verfügung unter www.hfbk-hamburg.de
[9] Sofern sie in den Jahren 2018 und 2019 künstlerisch tätig waren.
[10] In Deutschland lag das Verhältnis im Jahr 2013 laut der bereits erwähnten Galerienstudie entsprechend bei 75% zu 25%.
[11] Mania, Astrid: „Stadt, Land, Kunst – Messen werden für Galerien immer wichtiger. Der Umsatz ist hoch, das Risiko aber auch“, in: Süddeutsche Zeitung, Feuilleton/Kunstmarkt, 26./27. November 2016, S. 22, sowie http://www.sueddeutsche.de/kultur/kunstmessen-stadt-land-kunst-1.3266288?reduced=true




















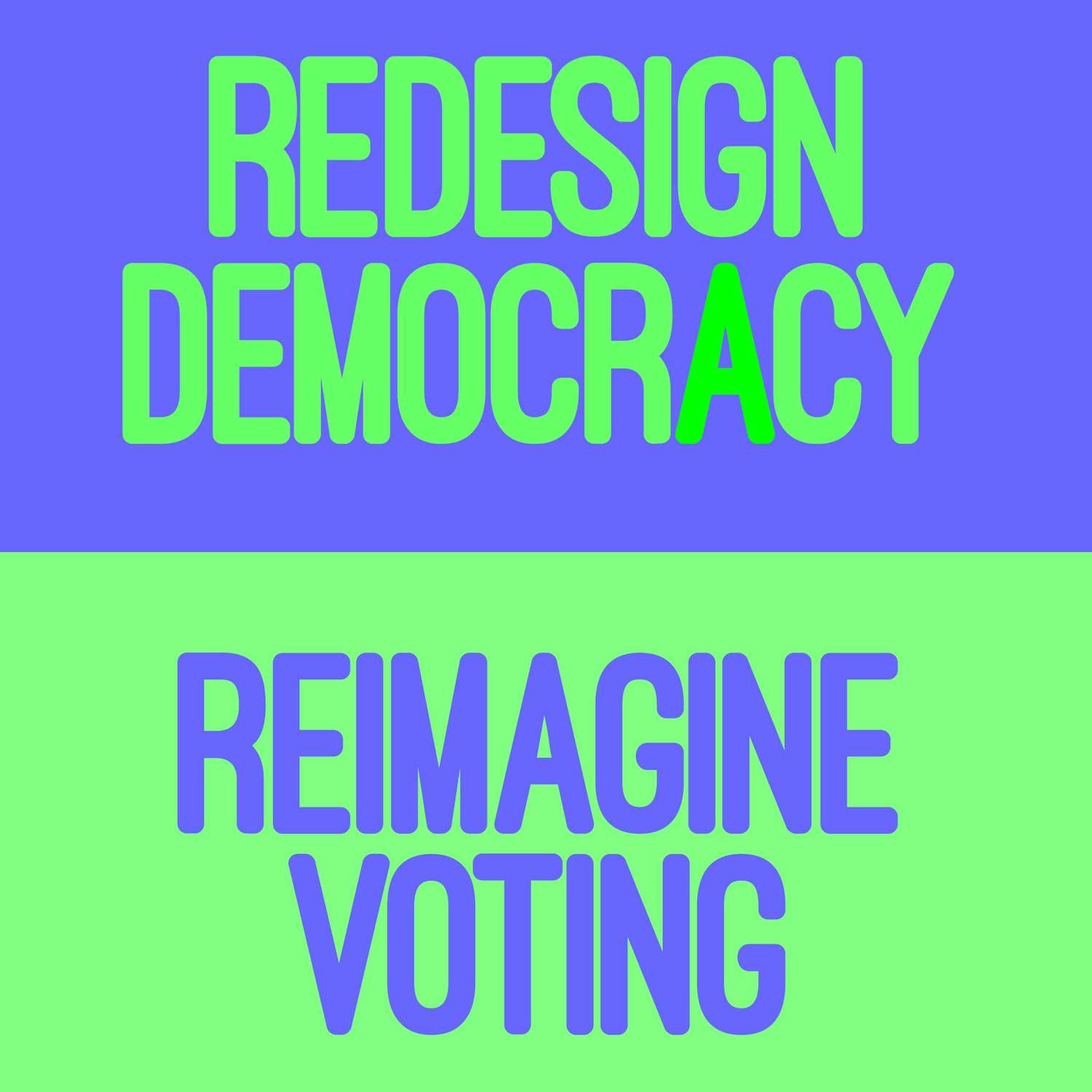























































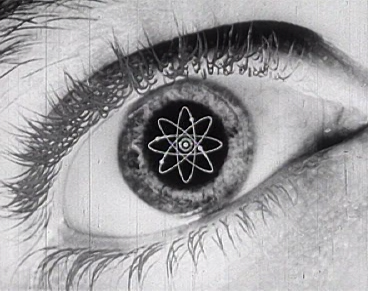
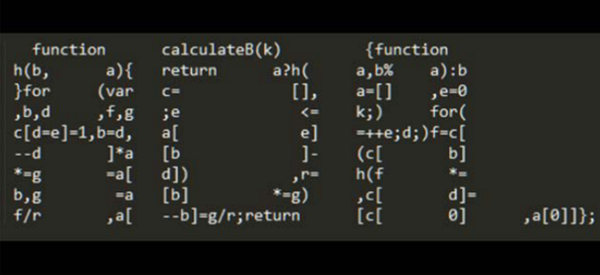
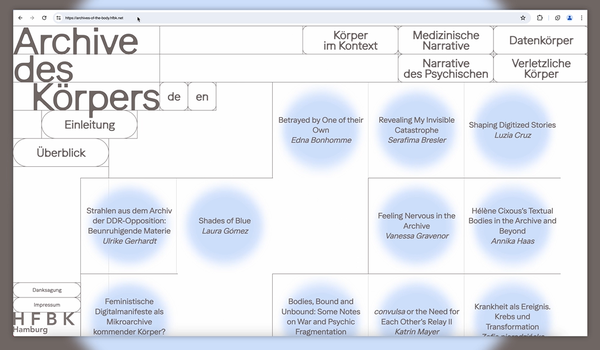



























































































































































 Graduate Show 2025: Don't stop me now
Graduate Show 2025: Don't stop me now
 Lange Tage, viel Programm
Lange Tage, viel Programm
 Cine*Ami*es
Cine*Ami*es
 Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft
Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft
 Kunst im öffentlichen Raum
Kunst im öffentlichen Raum
 How to apply: Studium an der HFBK Hamburg
How to apply: Studium an der HFBK Hamburg
 Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg
 Der Elefant im Raum – Skulptur heute
Der Elefant im Raum – Skulptur heute
 Hiscox Kunstpreis 2024
Hiscox Kunstpreis 2024
 Die Neue Frau
Die Neue Frau
 Promovieren an der HFBK Hamburg
Promovieren an der HFBK Hamburg
 Graduate Show 2024 - Letting Go
Graduate Show 2024 - Letting Go
 Finkenwerder Kunstpreis 2024
Finkenwerder Kunstpreis 2024
 Archives of the Body - The Body in Archiving
Archives of the Body - The Body in Archiving
 Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa
Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa
 Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg
 (Ex)Changes of / in Art
(Ex)Changes of / in Art
 Extended Libraries
Extended Libraries
 And Still I Rise
And Still I Rise
 Let's talk about language
Let's talk about language
 Graduate Show 2023: Unfinished Business
Graduate Show 2023: Unfinished Business
 Let`s work together
Let`s work together
 Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg
 Symposium: Kontroverse documenta fifteen
Symposium: Kontroverse documenta fifteen
 Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image
Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image
 Einzelausstellung von Konstantin Grcic
Einzelausstellung von Konstantin Grcic
 Kunst und Krieg
Kunst und Krieg
 Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun
Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun
 Der Juni lockt mit Kunst und Theorie
Der Juni lockt mit Kunst und Theorie
 Finkenwerder Kunstpreis 2022
Finkenwerder Kunstpreis 2022
 Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule
Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule
 Raum für die Kunst
Raum für die Kunst
 Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg
 Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments
Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments
 Diversity
Diversity
 Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021
Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021
 Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen
Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen
 Schule der Folgenlosigkeit
Schule der Folgenlosigkeit
 Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg
 Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020
Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020
 Digitale Lehre an der HFBK
Digitale Lehre an der HFBK
 Absolvent*innenstudie der HFBK
Absolvent*innenstudie der HFBK
 Wie politisch ist Social Design?
Wie politisch ist Social Design?