Promotionsvorhaben Wiebke Schwarzhans
Arbeitstitel:
Artifizielle Angriffsflächen. Feministische Perspektiven auf die Ambivalenz von Modephänomenen in der zeitgenössischen Kunst
Betreuung: Prof. Dr. Hanne Loreck, Prof. Jeanne Faust
In meinem künstlerisch-wissenschaftlichen Promotionsvorhaben verschränken sich im Forschungsprozess zwei Ebenen: (1) Die erste Ebene bildet der theoretisch-wissenschaftliche Teil Artifizielle Angriffsflächen in Form einer thesengeleiteten Analyse von Modephänomenen in ausgewählten künstlerischen Arbeiten, unter Bezugnahme auf feministische Mode-, Konsum- und Subjekttheorien. Zur analytisch-diskursiven Auseinandersetzung im theoretischen Teil kommt die sinnlich-erfahrbare Erkenntnisform des bildnerischen (Auf-)Zeigens durch die künstlerische Praxis gleichwertig hinzu. (2) Die Realisierung künstlerisch-forschender Projekte bildet die zweite Ebene, wie in Form der Videoperformance Le modèle optique.
Das Promotionsvorhaben ist in der Bildenden Kunst / Kunsttheorie angesiedelt und knüpft an Vertreter_innen feministischer Mode- und Konsumtheorien, psychoanalytischer Subjekttheorien sowie der Gender und Queer Studies an. Der Hauptfokus liegt mit einer feministisch-informierten Perspektive auf den ambivalenten Repräsentationen von Modephänomenen in der zeitgenössischen Kunst. Als „Modephänomene“ verstehe ich Zitate von Mode in künstlerischen Arbeiten, wie z.B. Rückgriffe auf Modemagazine, Modekampagnen und ihre Ästhetiken sowie Modekleidung (vestimentäre Artefakte) als Referenz auf „Look“ und „Style“. Das Zitieren von Modephänomenen in künstlerischen Produktionen hat in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung erfahren. Gleichzeitig stiftet es oftmals Verwirrung zwischen den Disziplinen oder wird als kommerzielle Komplizenschaft begriffen, und damit auch als Angriffsfläche für Kritik.
Das Promotionsvorhaben gliedert sich in drei analytische Hauptstränge:
- Anhand exemplarischer Analysen wird gefragt, wie moderne und zeitgenössische künstlerische Arbeiten die Ambivalenz von Modephänomenen – und damit auch von Konsumkultur, Geschlecht und Begehren im Kapitalismus – reflektieren und/oder transformieren sowie bestenfalls im Sinne einer emanzipatorischen visuellen Politik produktiv machen.
- In der Auseinandersetzung mit Style wird Mode als möglicher politischer Ausdruck sichtbar, indem Positionierungen durch Kleidung, Haarstyling und Accessoires ausgedrückt und auch angeeignet werden können (entlang verschiedener Achsen sozialer Differenzkategorien: beispielsweise über Klassen- und Geschlechtergrenzen hinweg, aber ebenso in Form von „cultural appropriation“). Dabei ist zu diskutieren, welche Bedeutungen Referenzen auf modische Styles in künstlerischen Arbeiten produzieren.
- Die „artifiziellen Angriffsflächen“ werden dabei als Anknüpfungspunkte für feministische Theoriediskurse verstanden. Mit Re-Lektüren werden, unter Berücksichtigung impliziter Genderpolitiken im Verhältnis der angewandten und bildenden Künste, feministische und gendertheoretische Lesarten aktualisiert und herausgearbeitet.
Das Promotionsvorhaben leistet so einen Beitrag zur Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst in ihrer Verwobenheit mit mode- und gendertheoretischen Fragestellungen aus künstlerisch-forschender Perspektive.
Das künstlerische Promotionsprojekt Le modèle optique erforscht mit Hilfe des Mediums Video die Konstruktion von Wirklichkeit, Subjektivität und Geschlecht anhand von Spiegelungen, optischen Illusionen, modischen Körpern und Fragen virtueller Realität. Die Videoperformance verschränkt einen physikalischen Versuchsaufbau, in Anlehnung an den Psychoanalytiker Jacques Lacan, mit ästhetischen Bildpolitiken aktueller Modekampagnen in einer performativen Reinszenierung. In Zeiten der Digitalisierung ist die Lebenswelt geprägt von den spiegelnden Glasoberflächen der Displays und Screens, von virtuellen Welten und damit möglicherweise auch neuen, virtuellen Verhältnissen zum Selbst. Die Videoperformance Le modèle optique versteht sich als Untersuchung dieser Phänomene und deren Auswirkungen auf die Subjekte, auch in ihrer Körperlichkeit. Durch die künstlerisch-praktische Arbeit können bildpolitische Verschiebungen von Blickweisen sowie von festgefügten Wahrnehmungsordnungen nicht nur theoretisch, sondern auch unmittelbar sinnlich-perzeptiv erfahren werden.
Vita:
Wiebke Schwarzhans (*1985 in Münster / Deutschland) lebt und arbeitet in Hamburg. Sie studierte Bildende Künste und Kunsttheorie sowie Psychologie und Gender Studies in Hamburg und Wien. Seit 2016 künstlerisch-wissenschaftliche Promotion mit dem Arbeitstitel „Artifizielle Angriffsflächen. Feministische Perspektiven auf die Ambivalenz von Modephänomenen in der zeitgenössischen Kunst“ bei Prof. Dr. Hanne Loreck und Prof. Jeanne Faust an der HFBK Hamburg. Seit 2013 im kuratorischen Team der Ausstellungsreihe „Folgendes“ aktiv, führt sie Artist Talks und ist Herausgeberin der „Folgendes“-Publikation Bewegungsformen (Materialverlag 2016). Ihre Schwerpunkte sind Spiegel- und Oberflächenphänomene, Psychoanalyse, feministische Theorien, Modetheorie sowie modische Artikulationsformen. Sie arbeitet projektbezogen und medienübergreifend. Aktuell erkundet sie das Accessoirehafte sowie die Materialität von Porzellan bis hin zu dessen brüchigen Grenzen. Sie ist Promotionsstipendiatin der Heinrich-Böll-Stiftung.
Kontakt: info@wiebkeschwarzhans.de







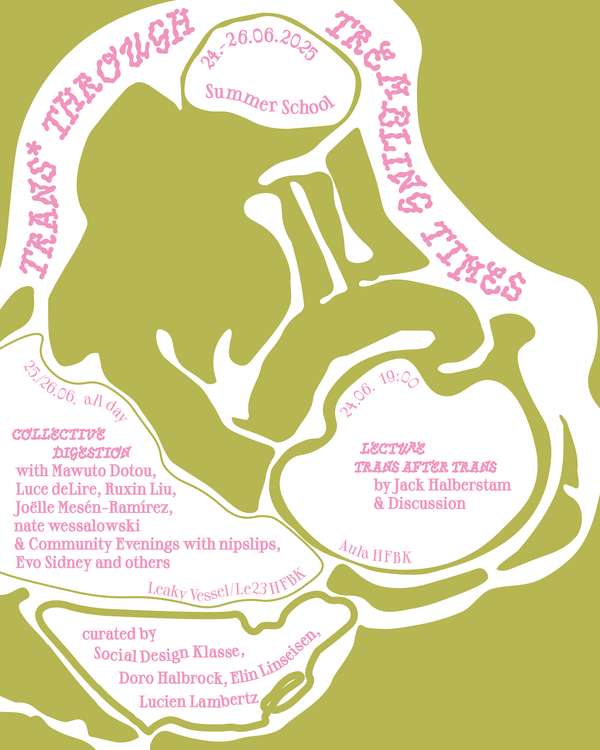





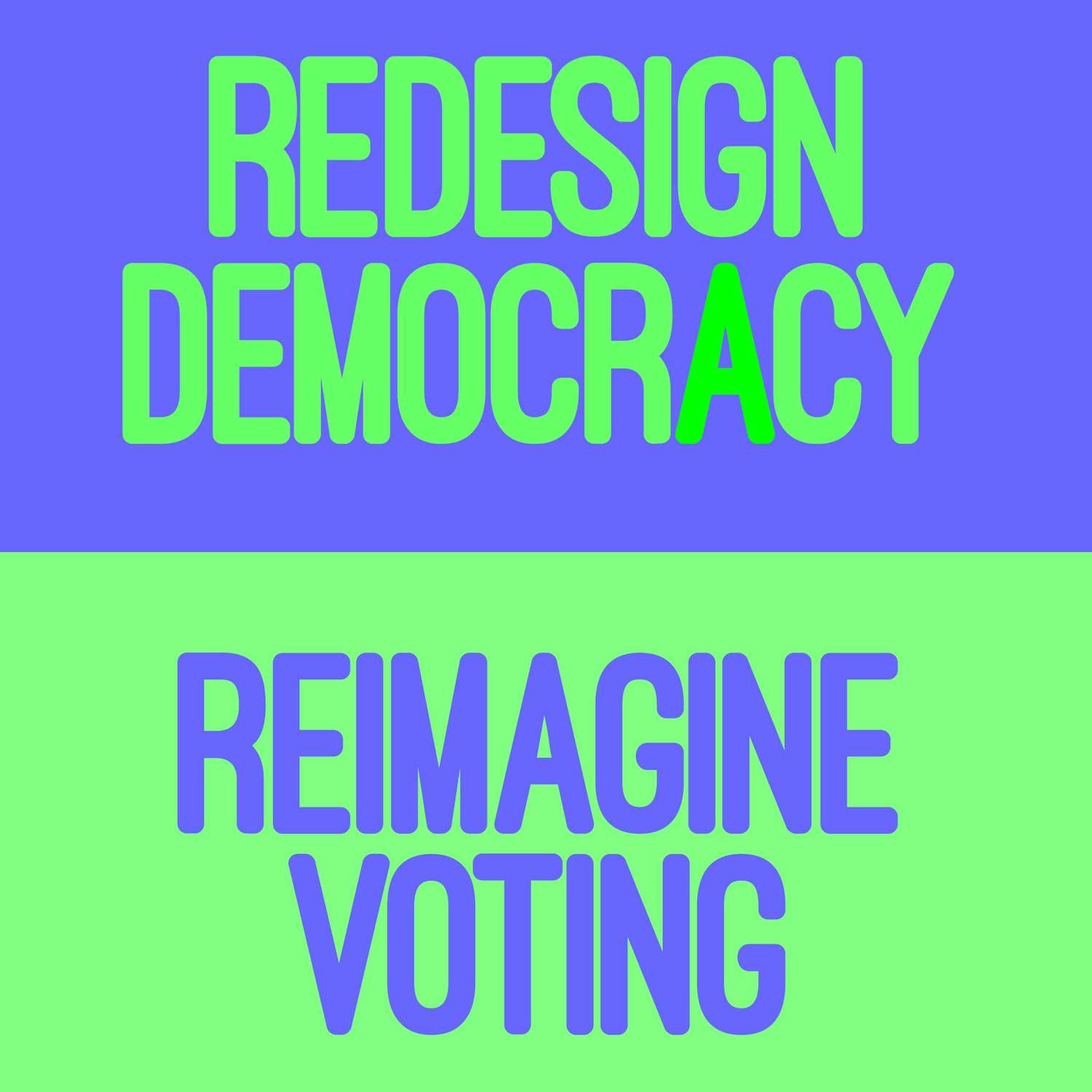











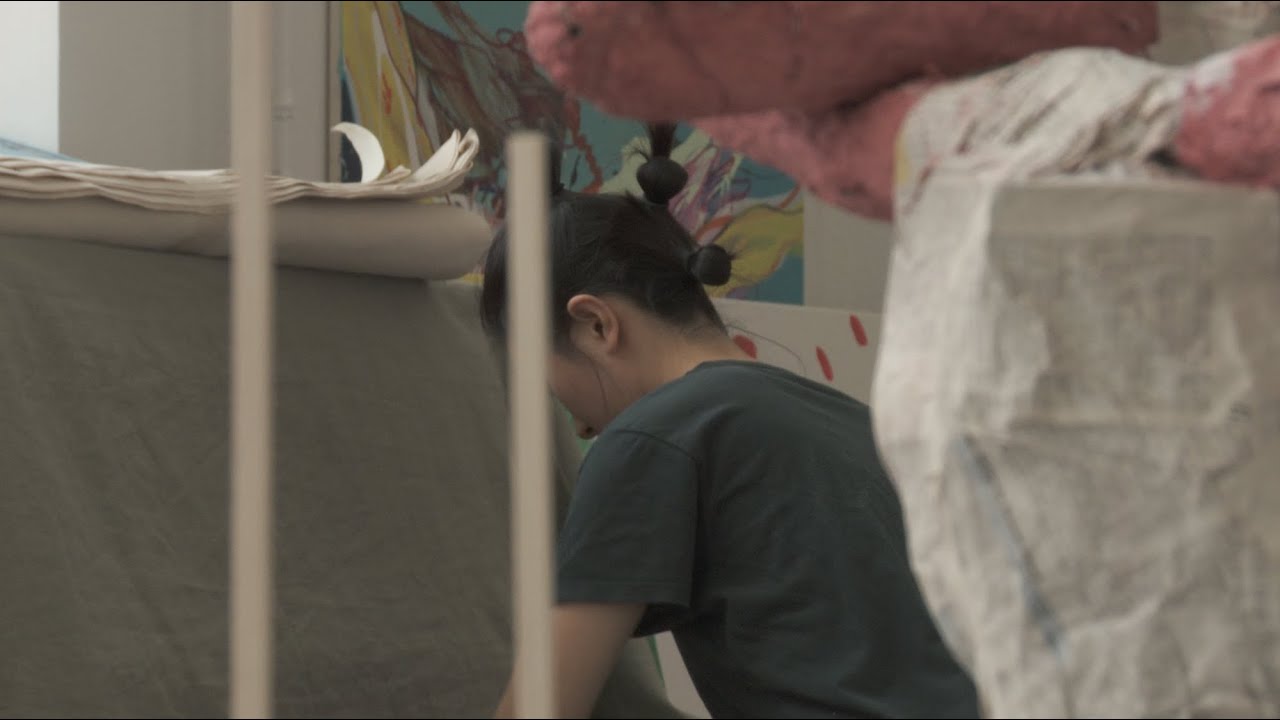






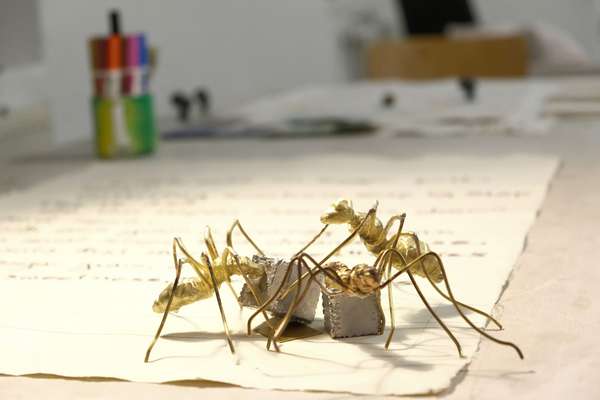



















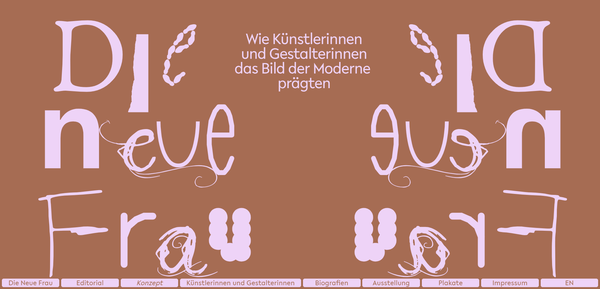
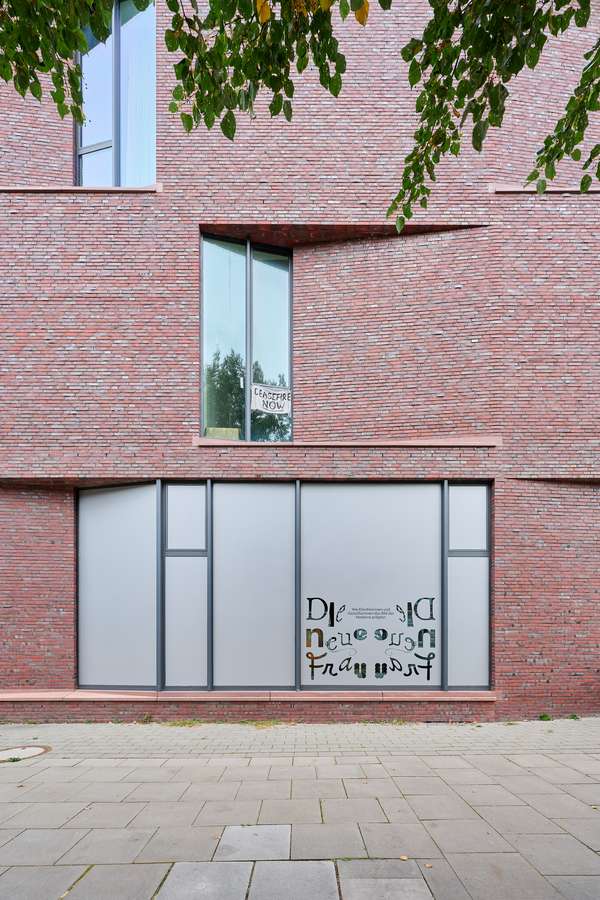



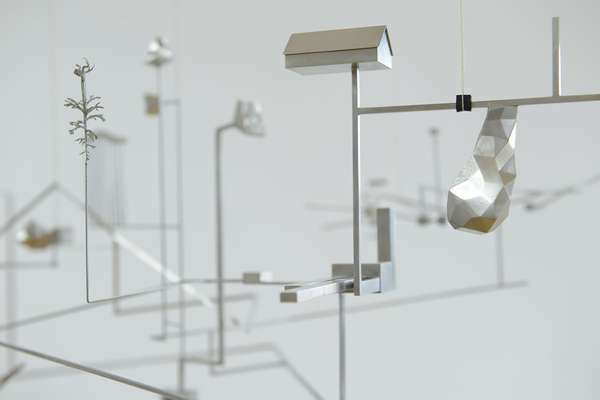











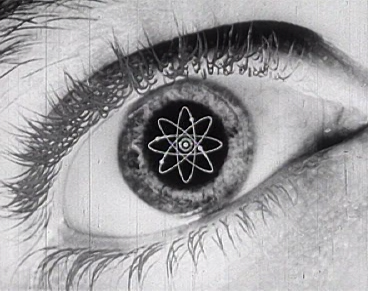
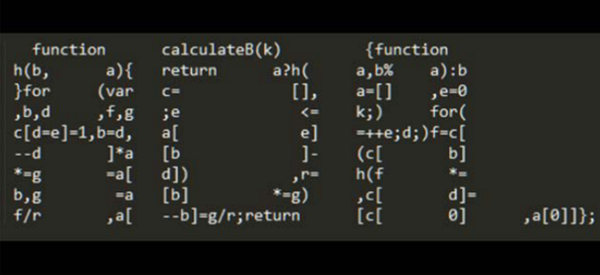
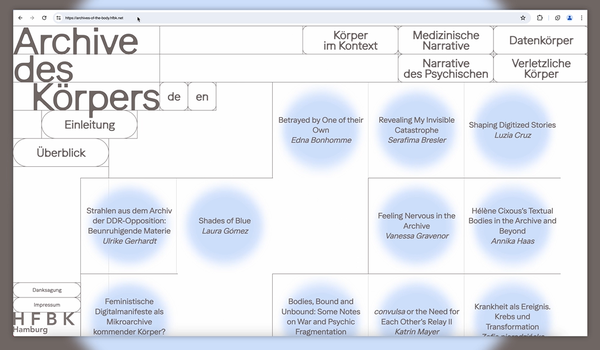
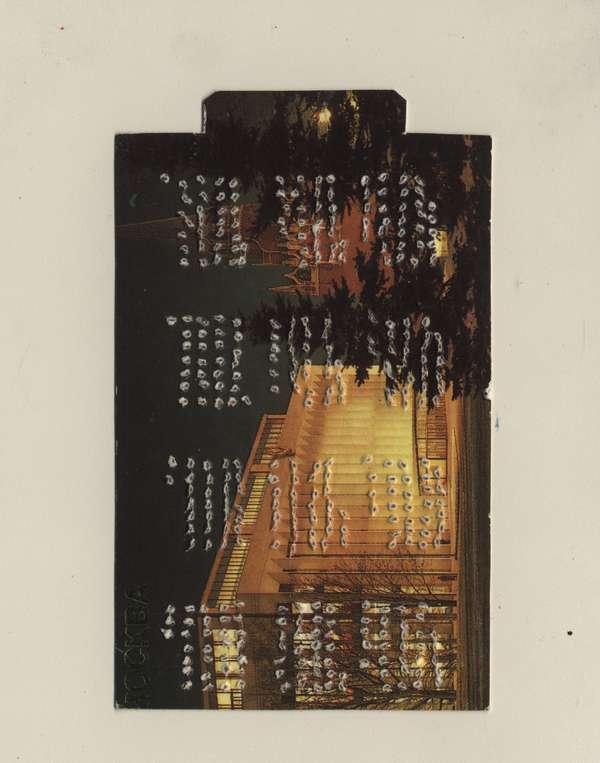
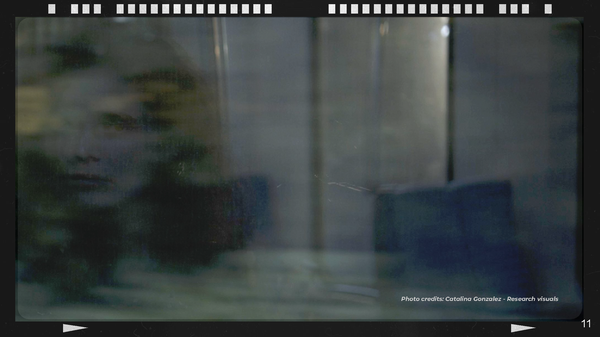



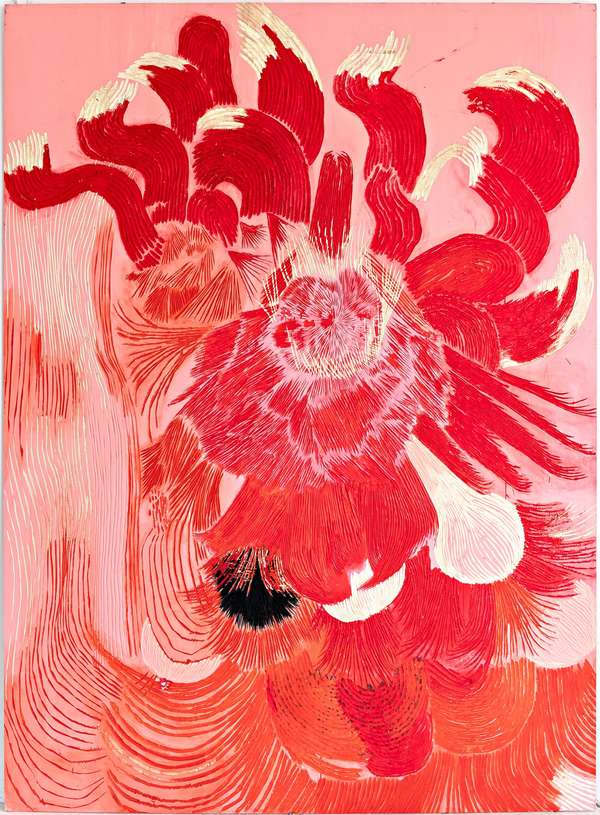







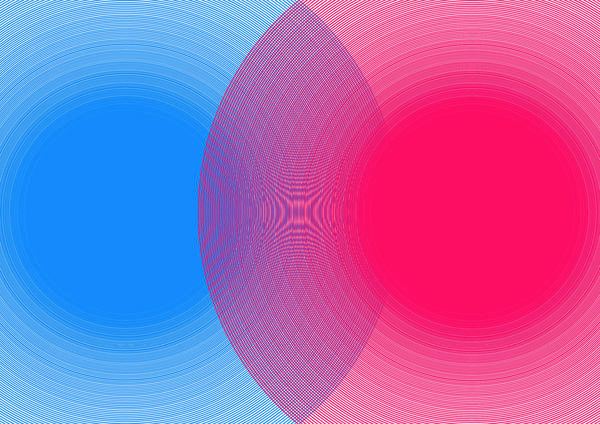






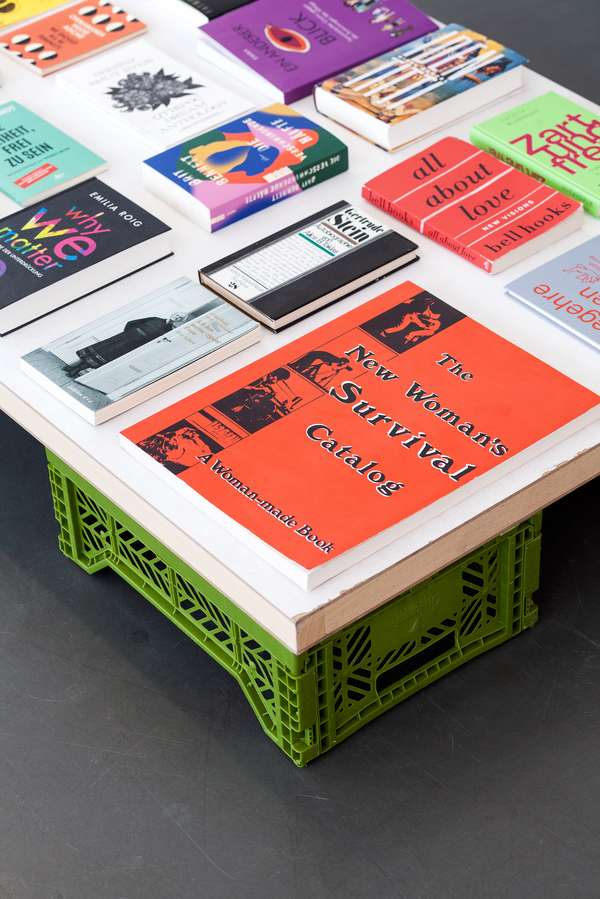



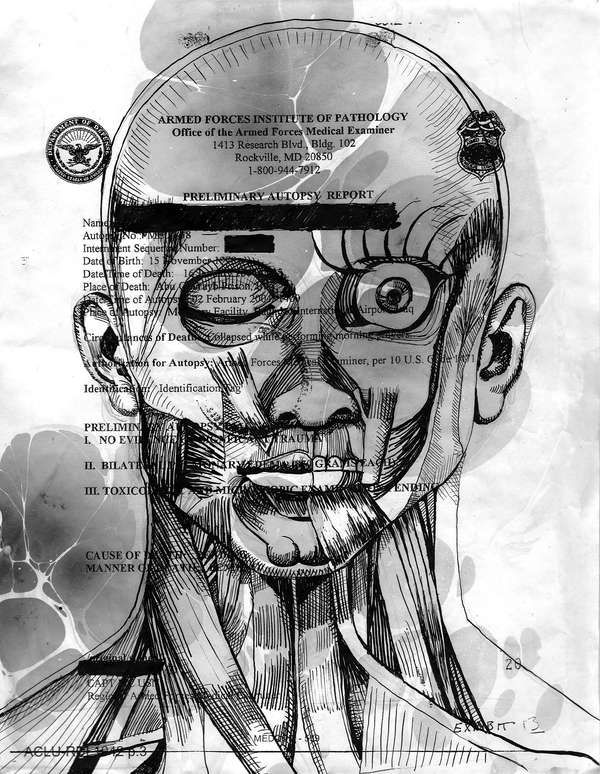

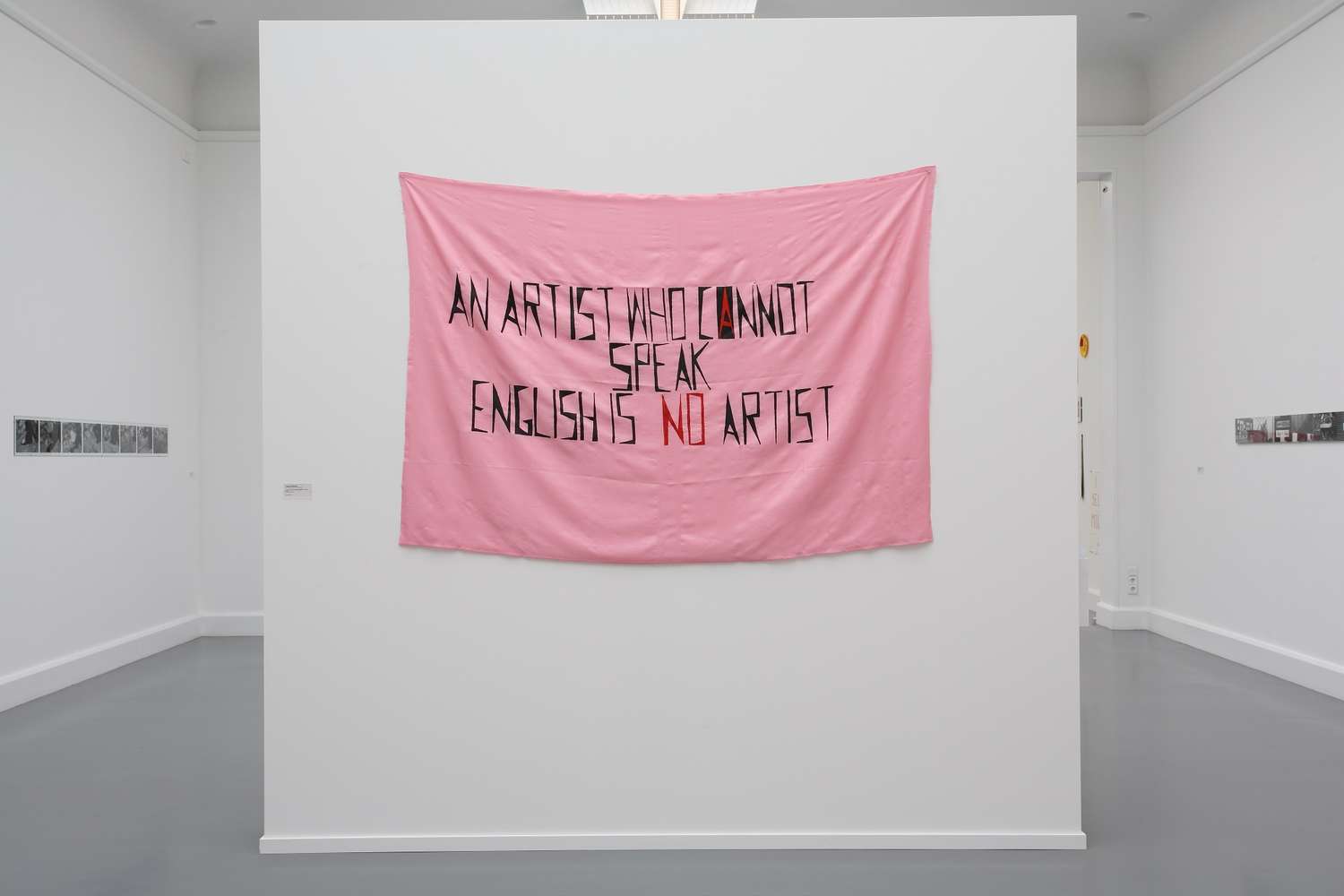

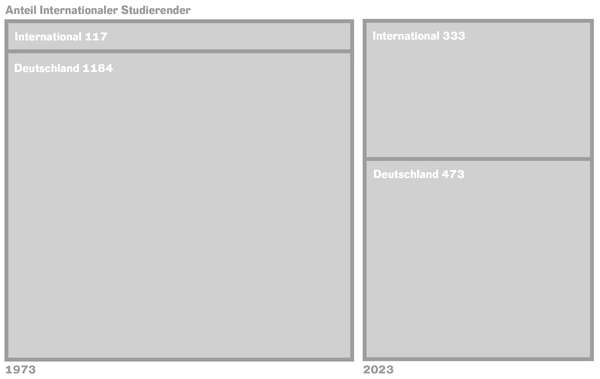
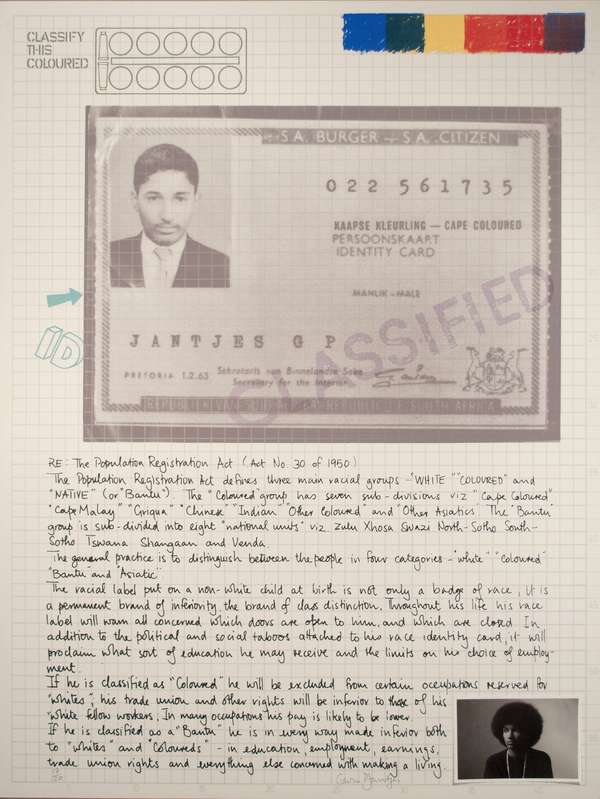
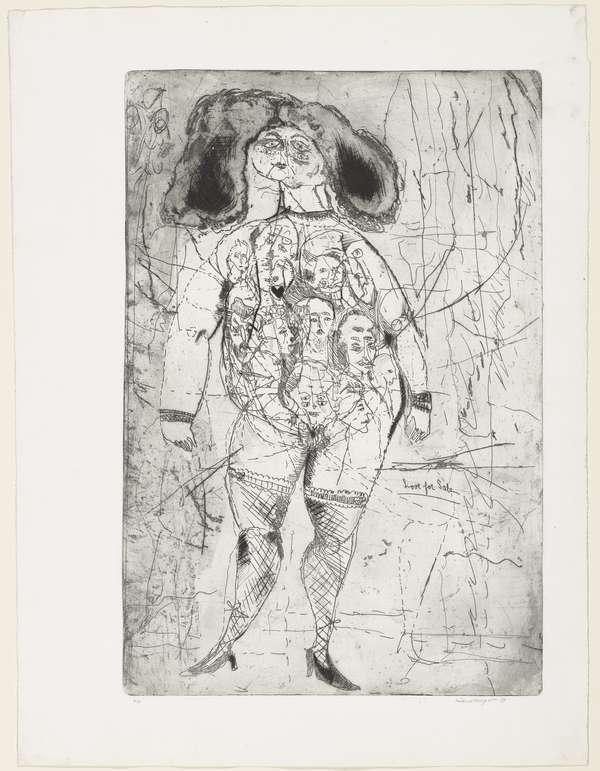
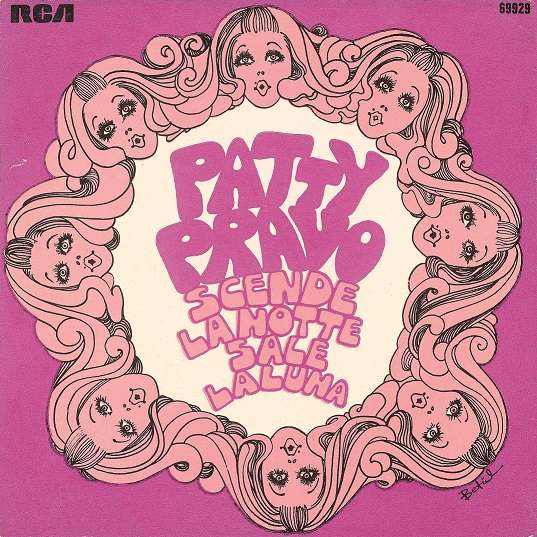





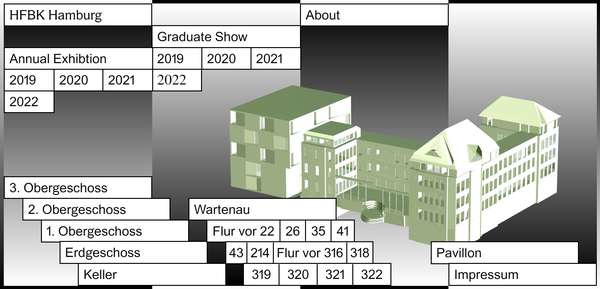
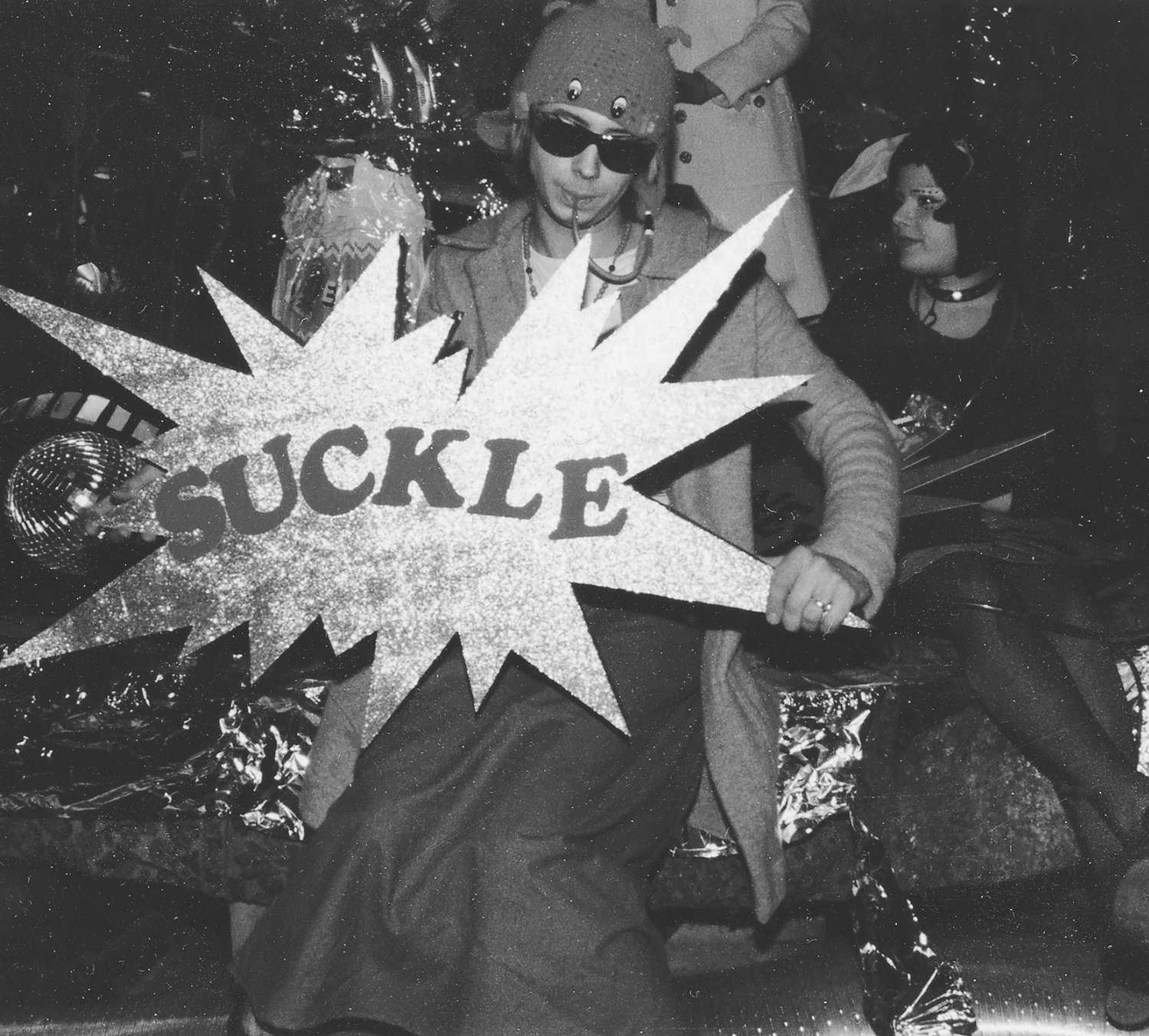



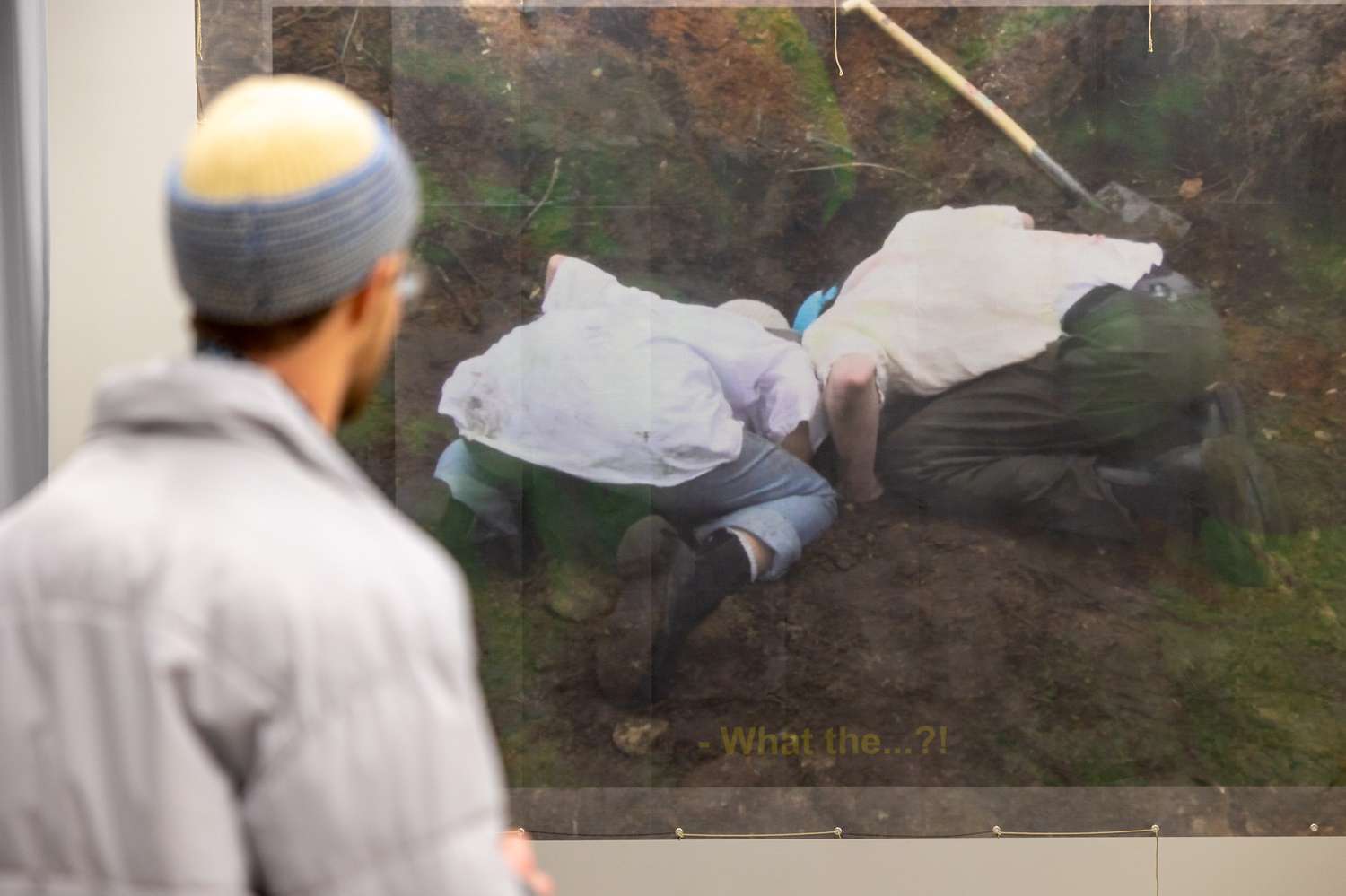


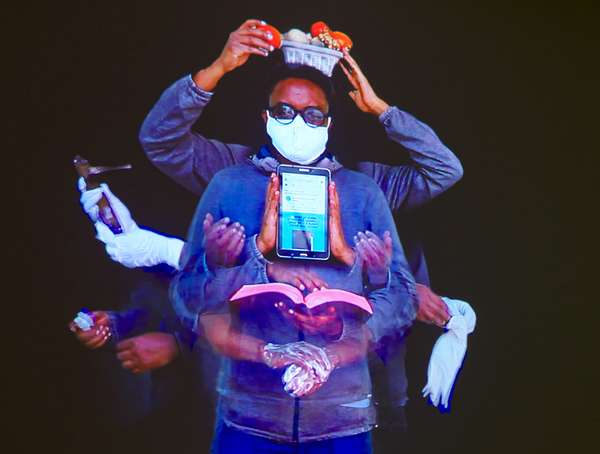
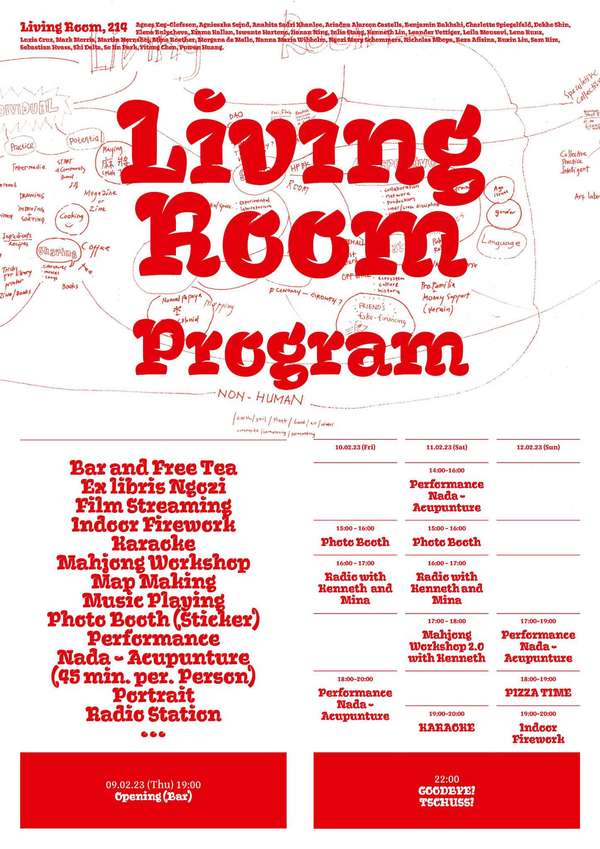
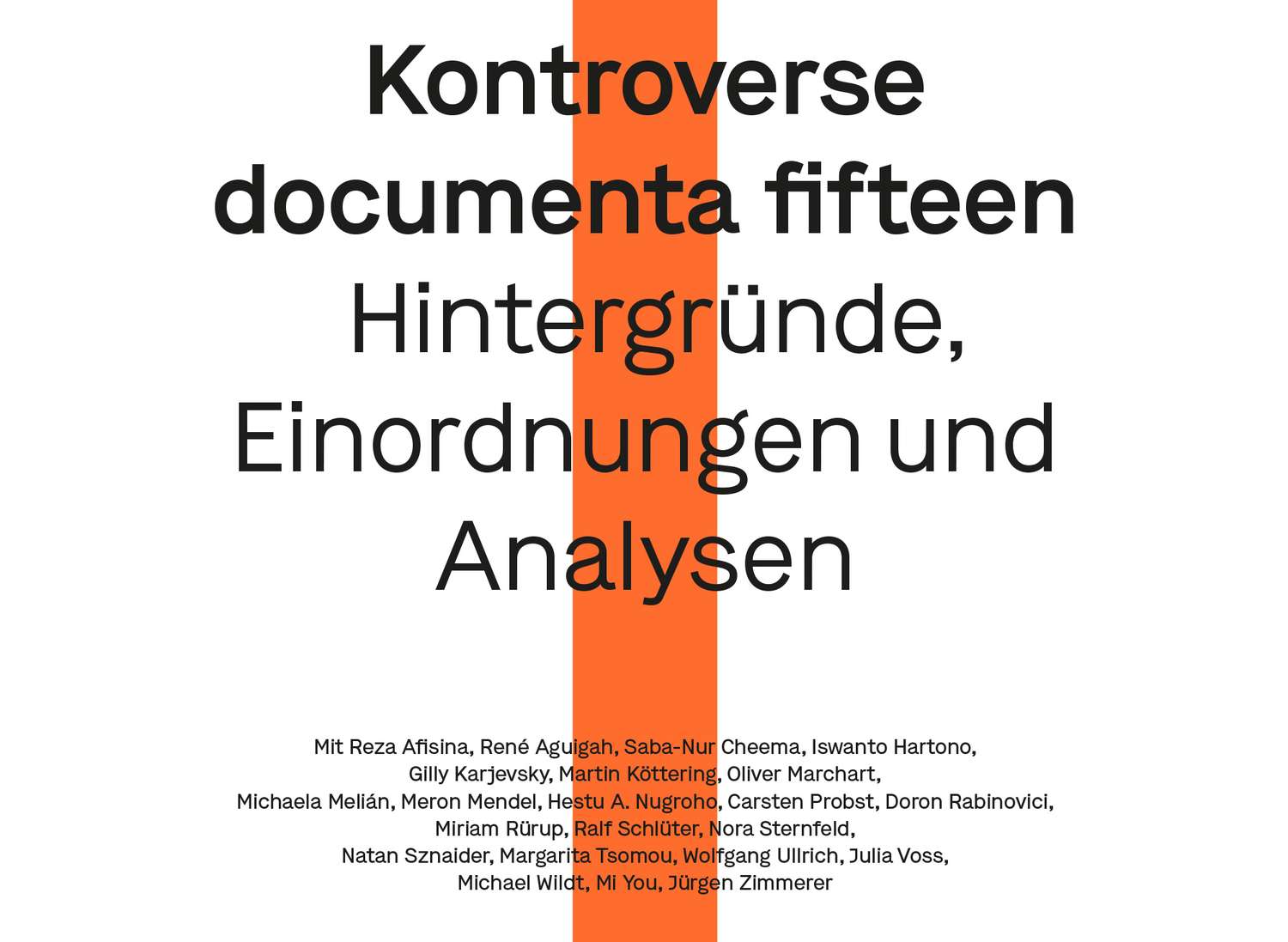




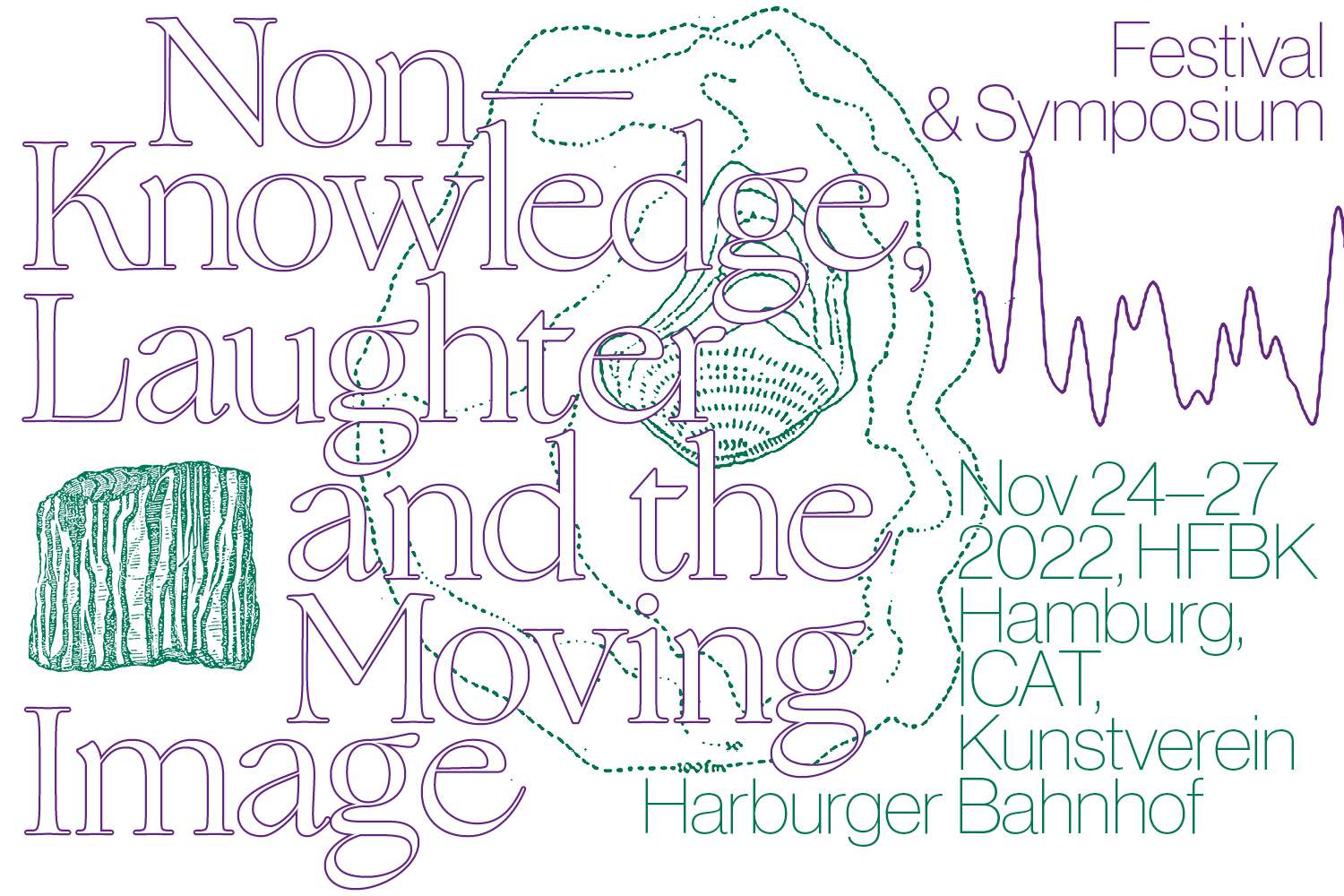









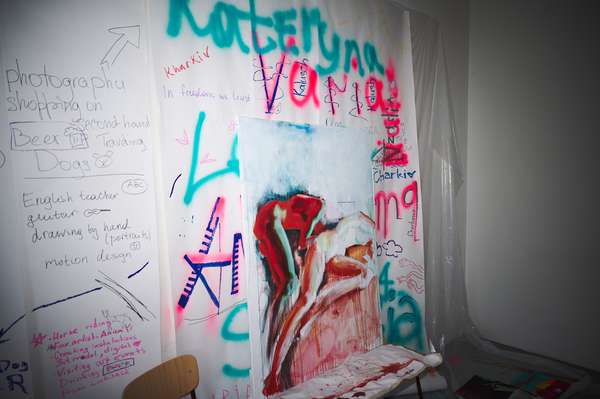




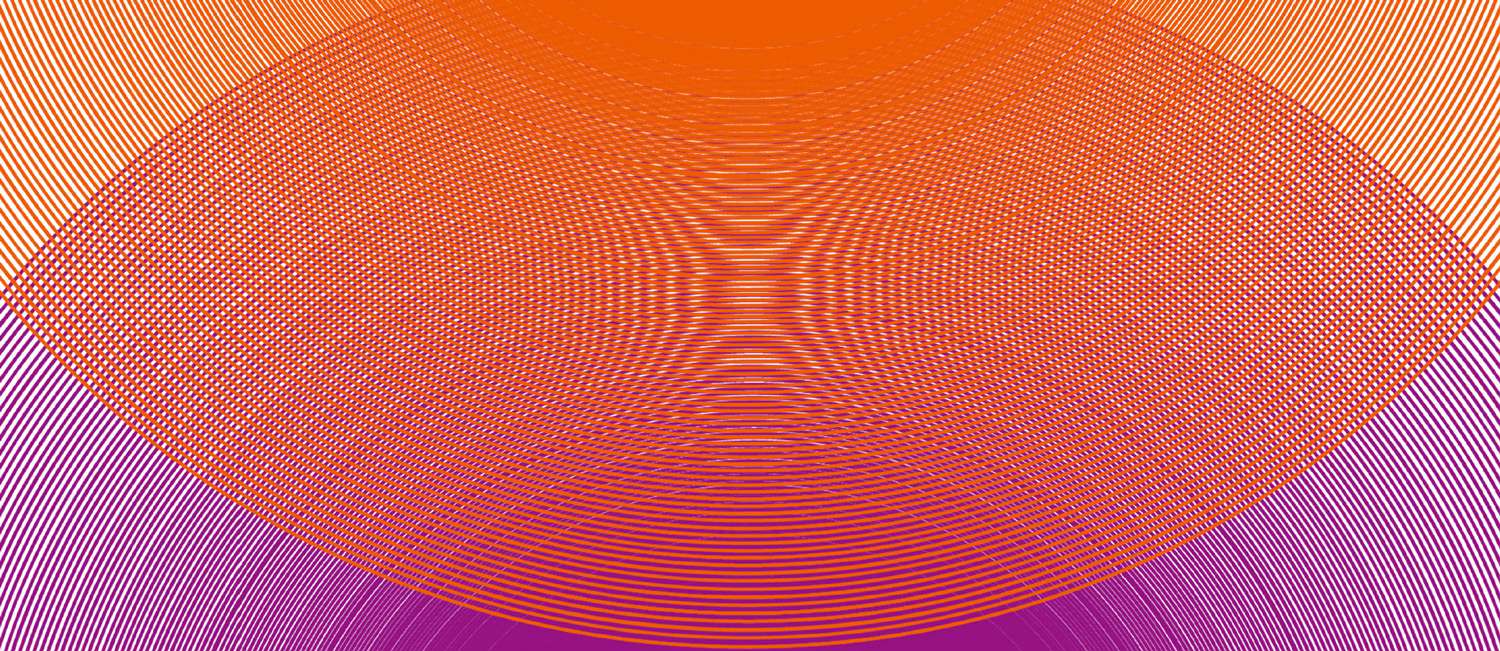
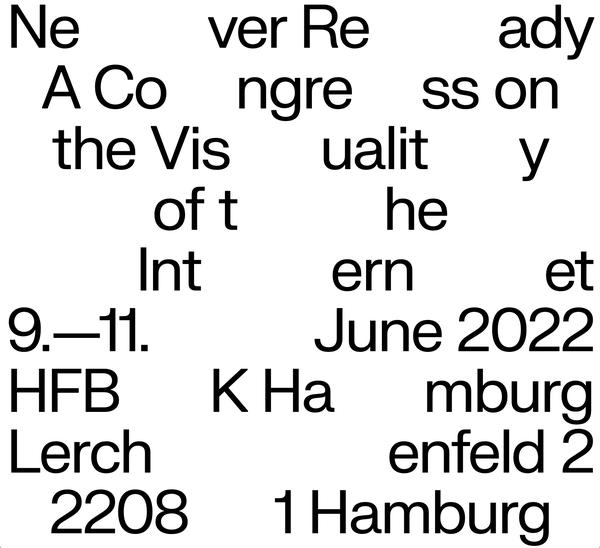
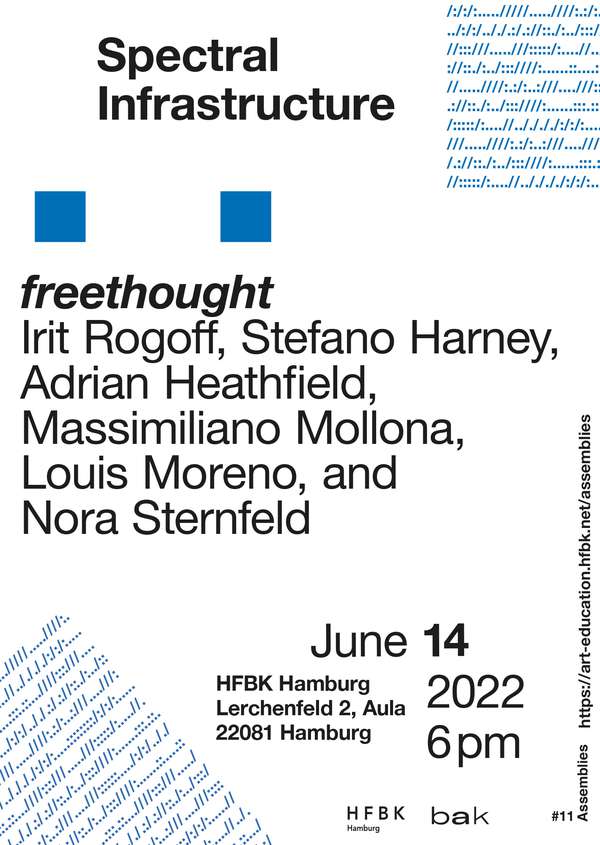

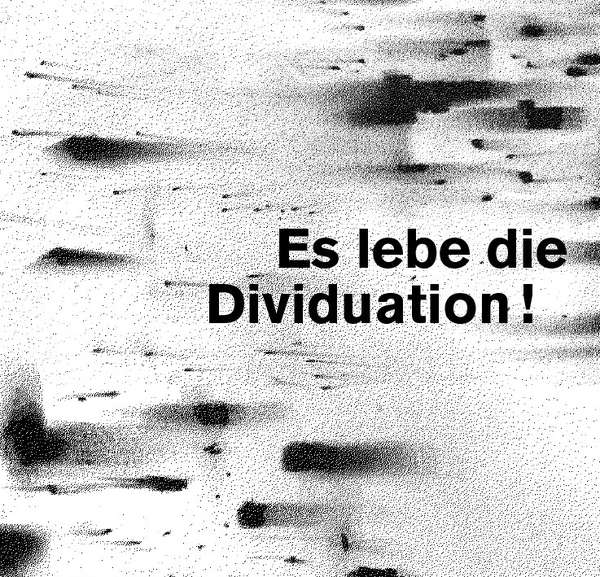
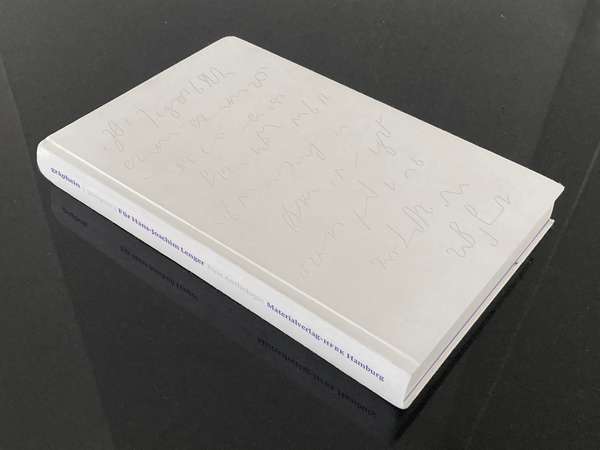
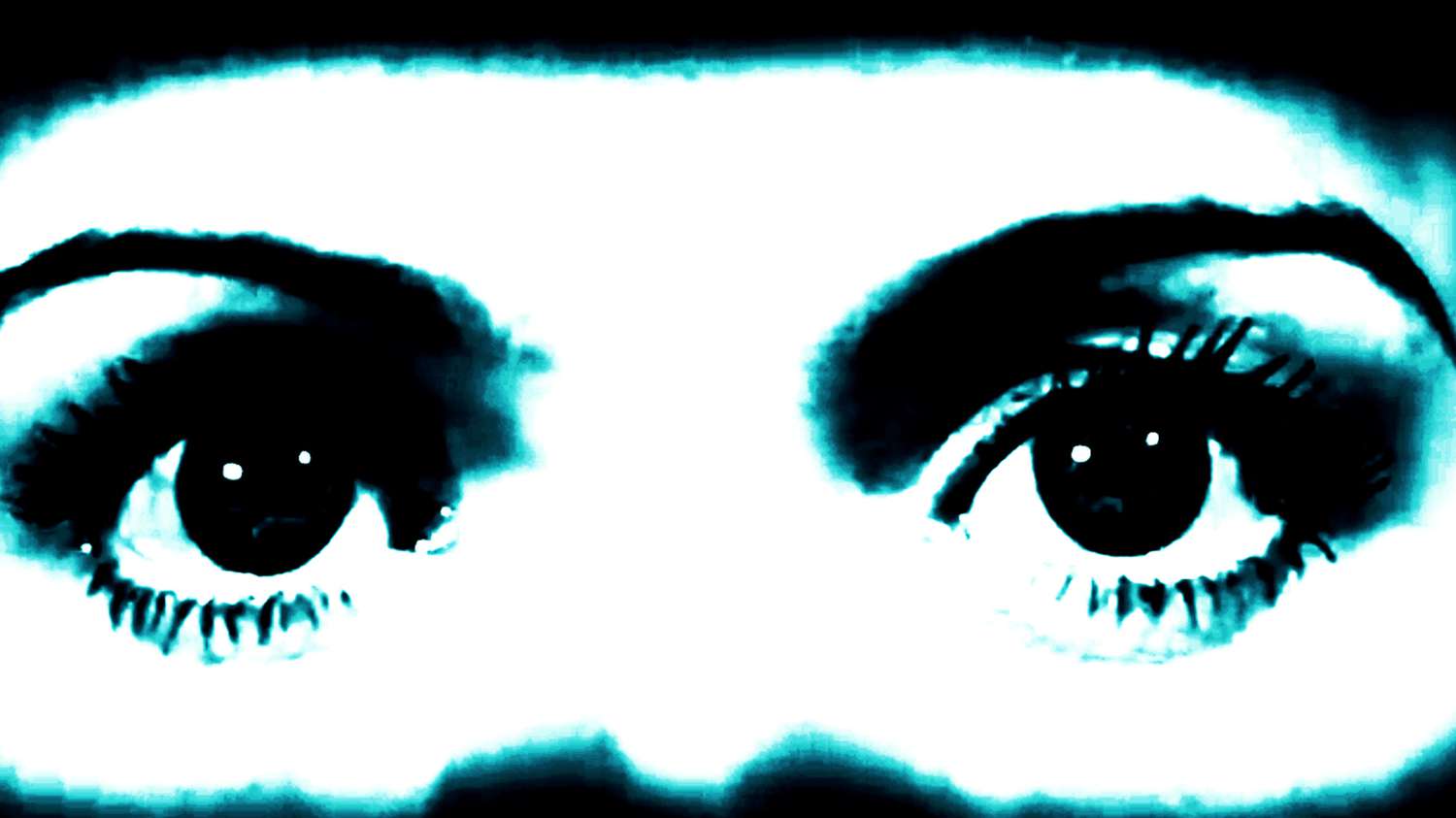
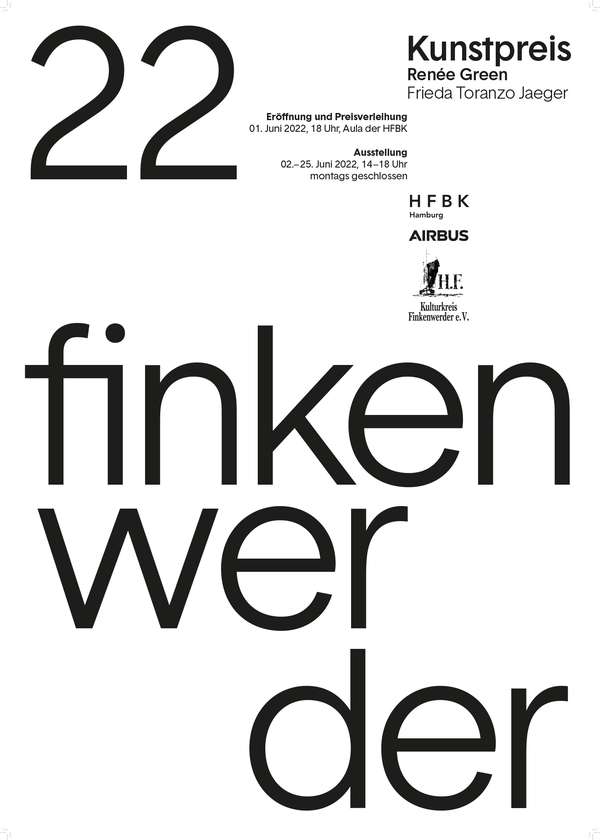















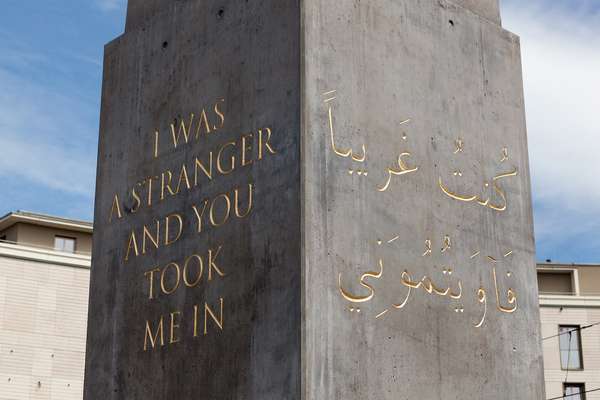
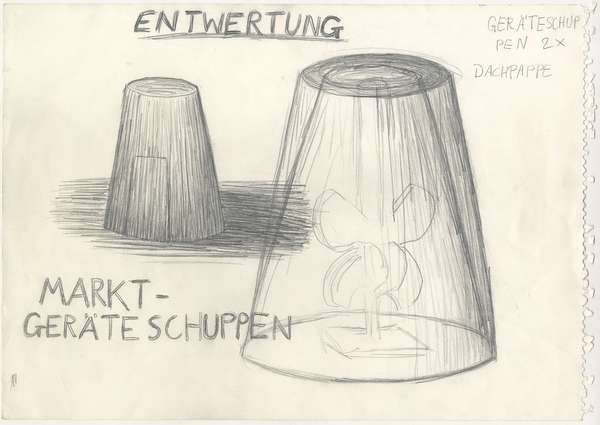
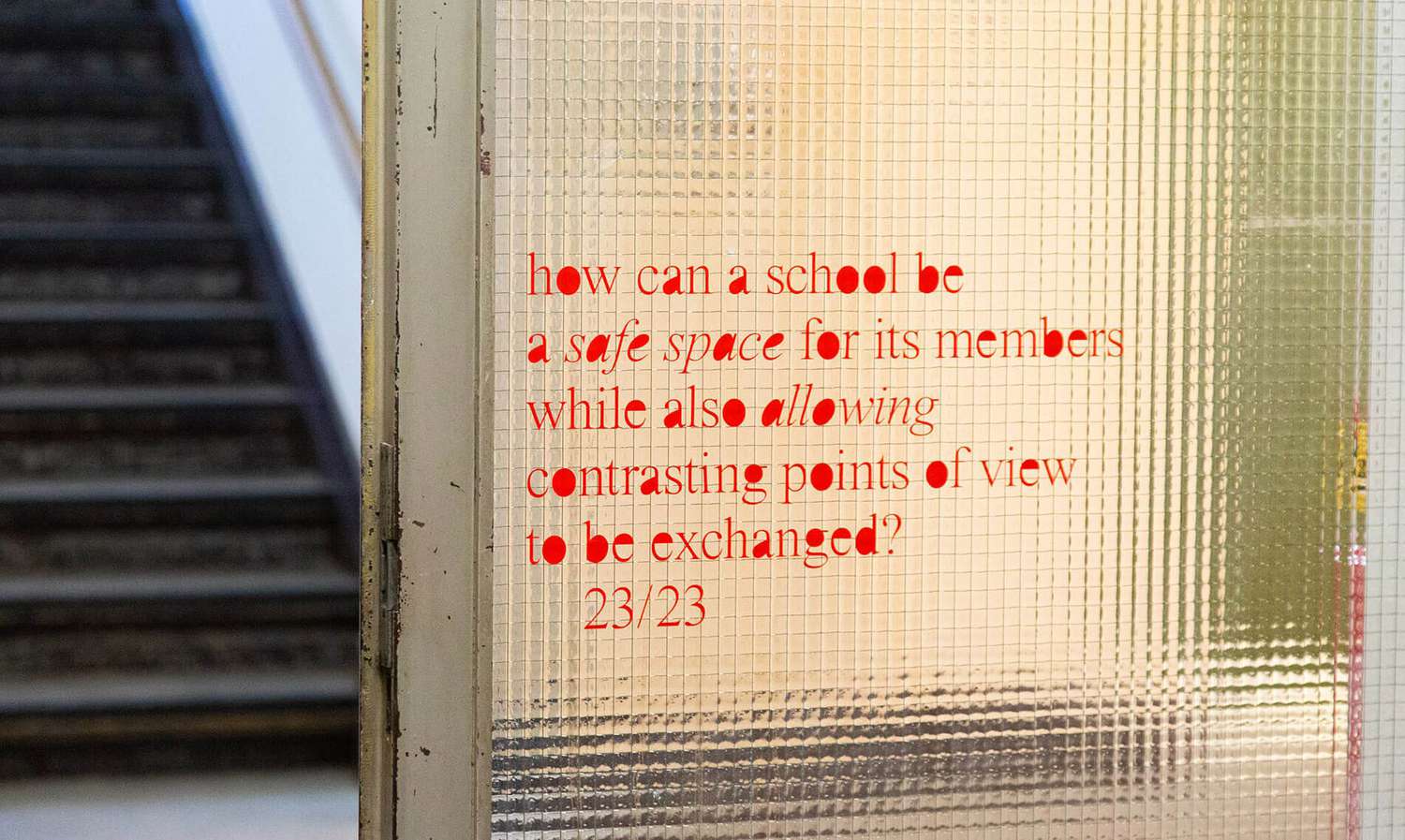

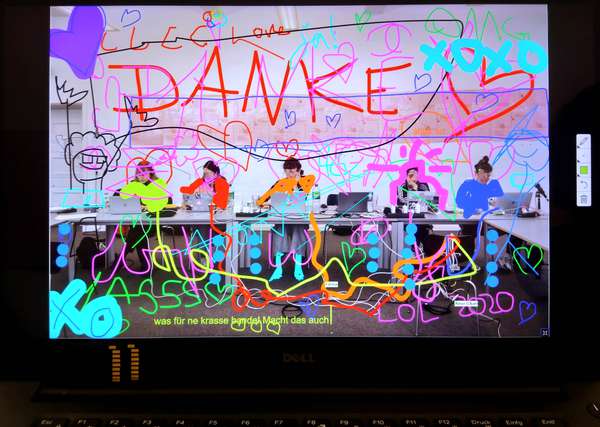
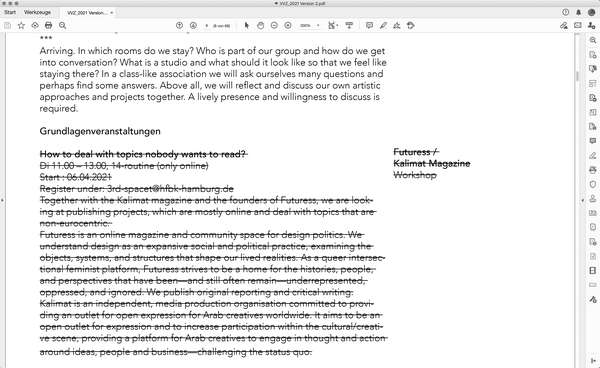
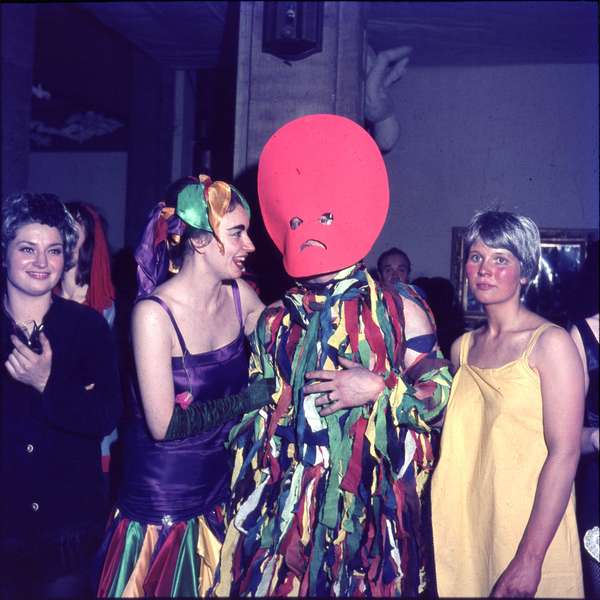





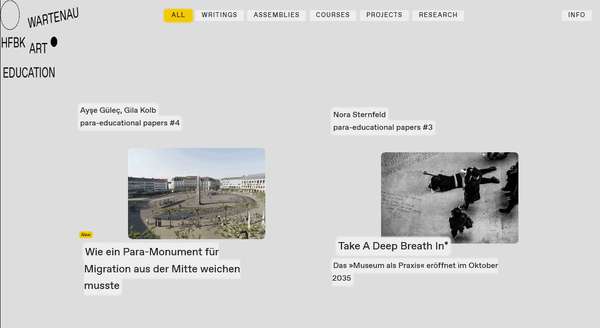

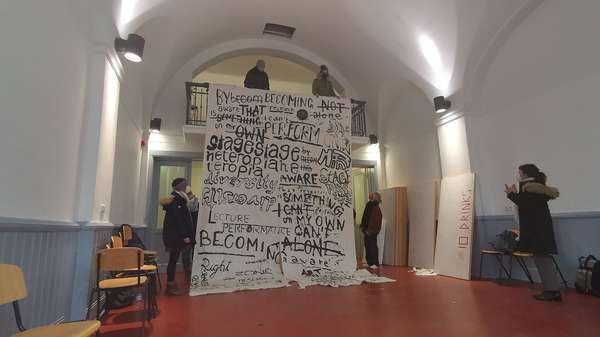
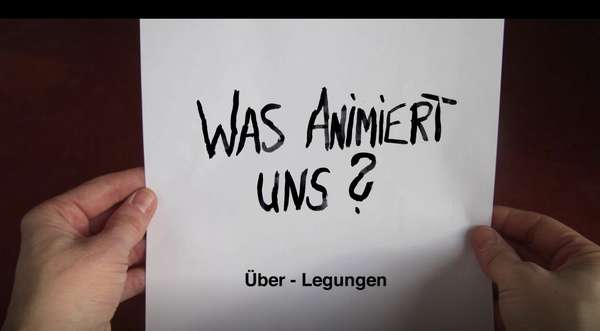





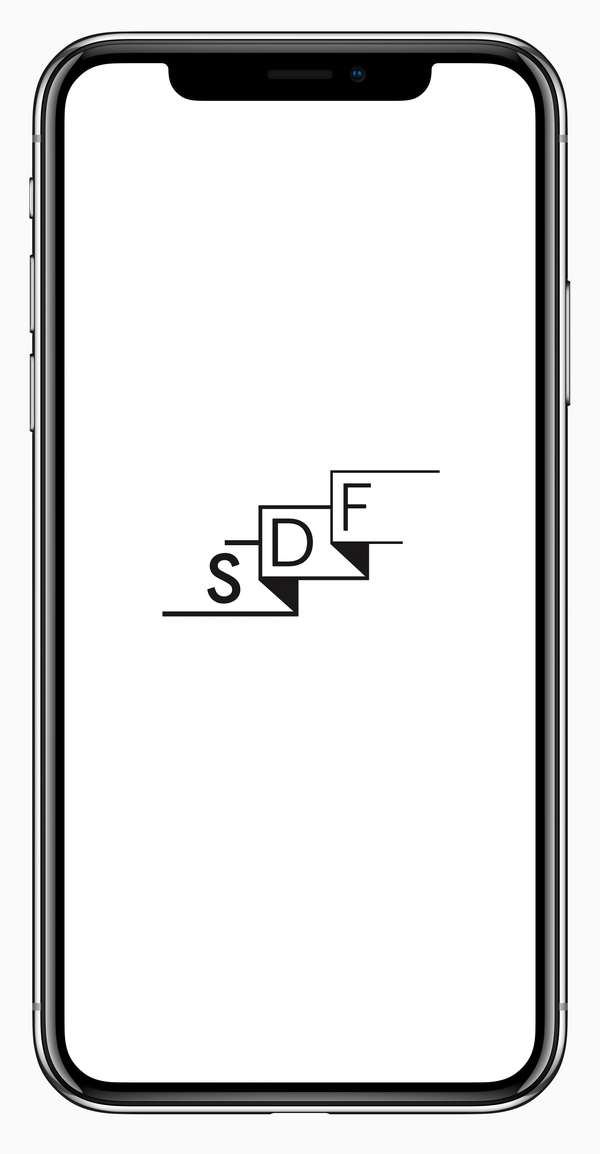
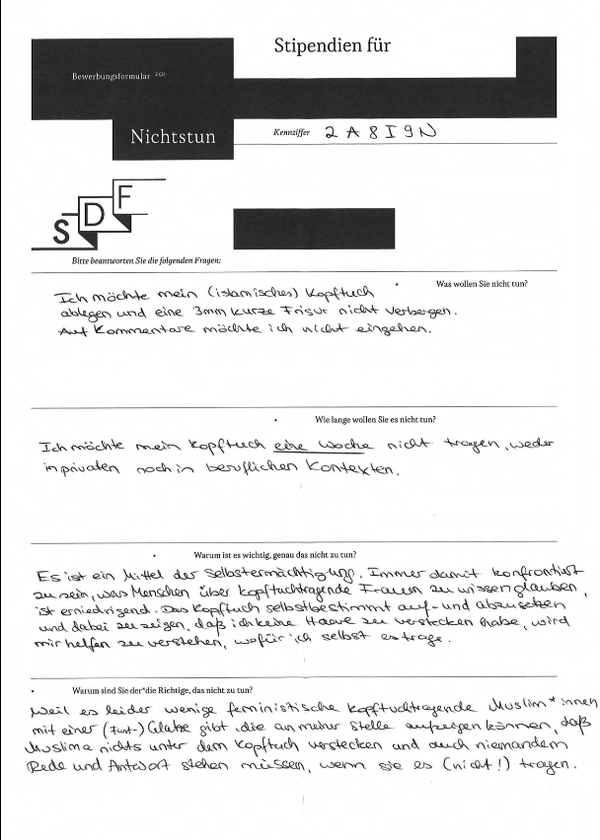


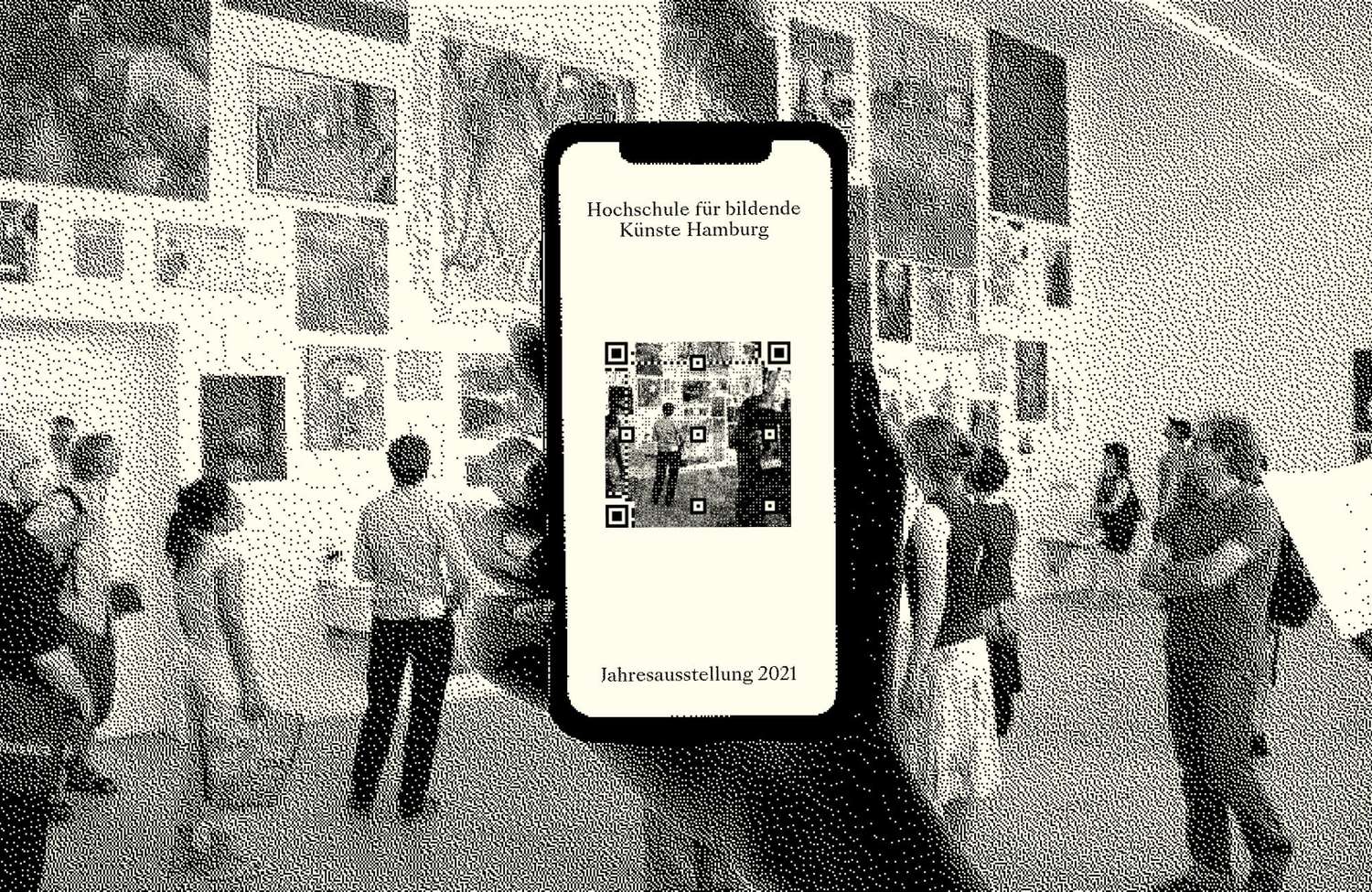

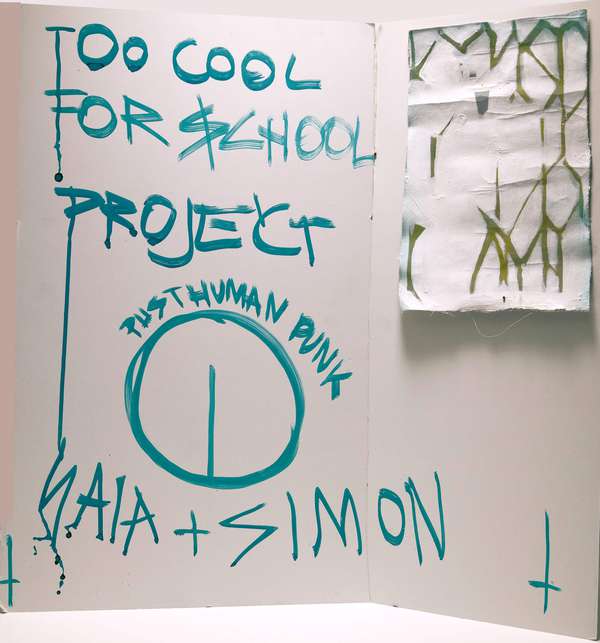

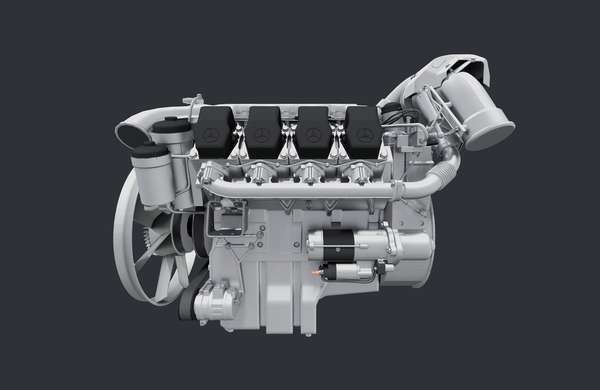





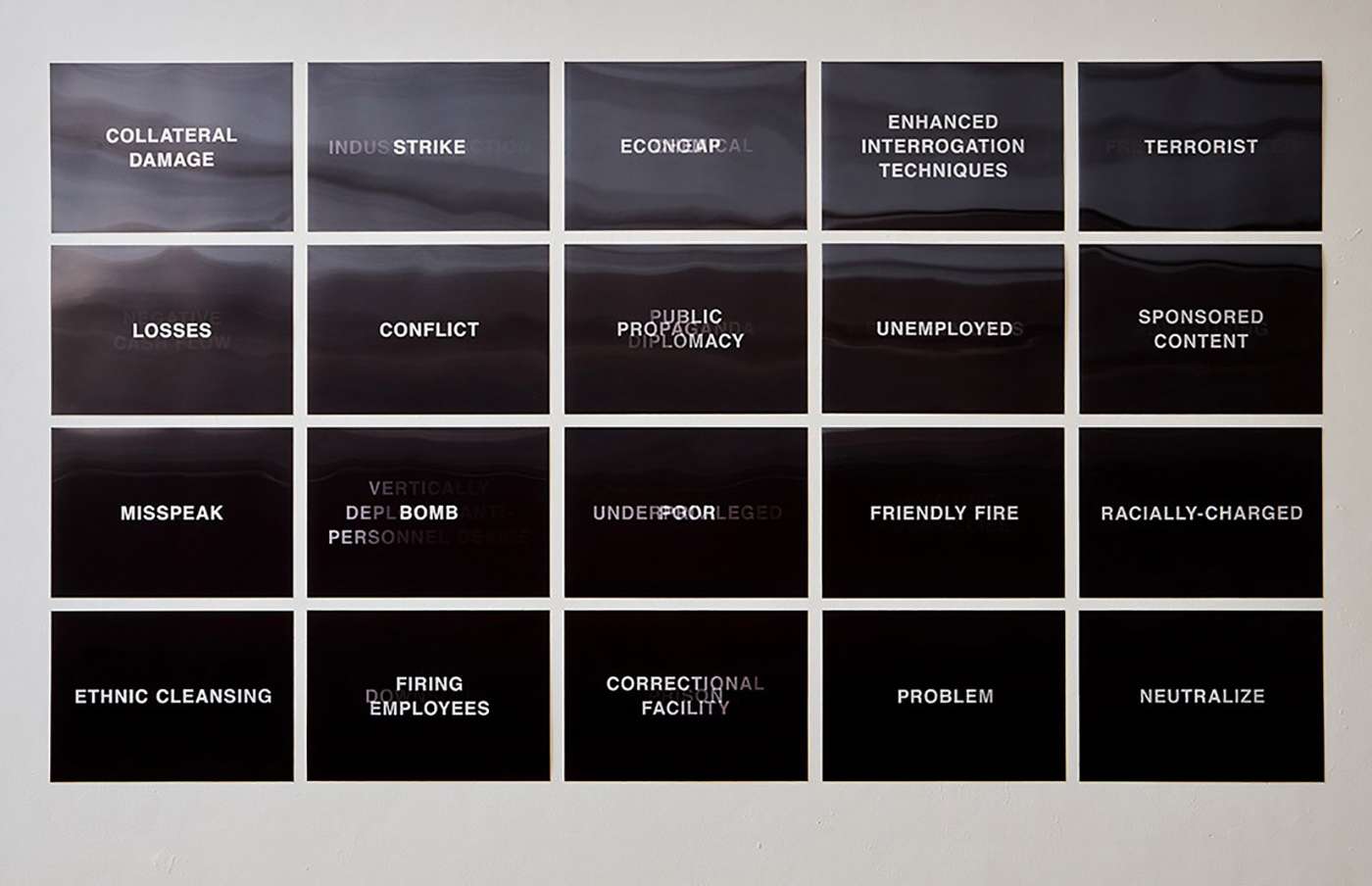




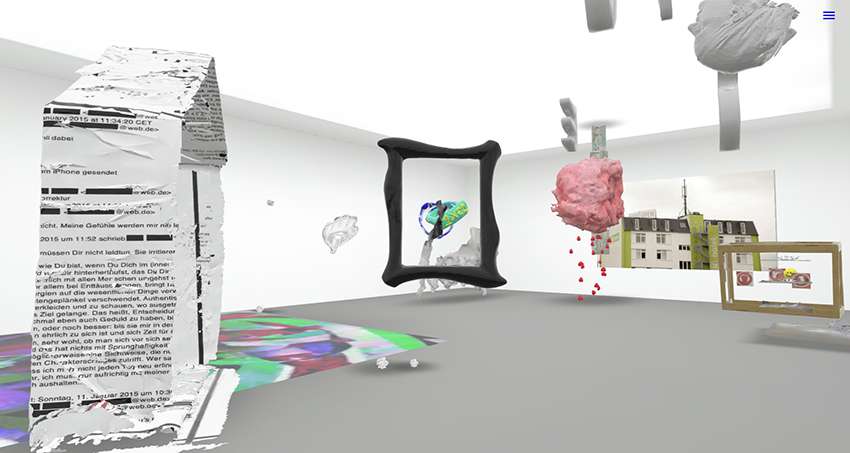
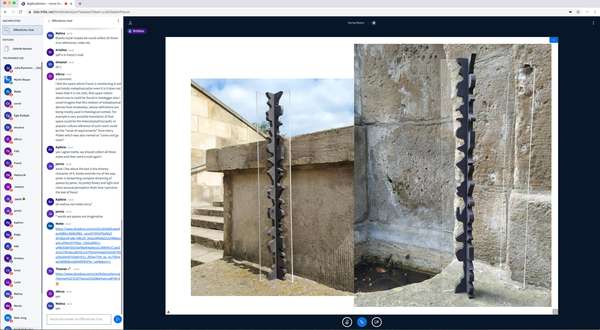
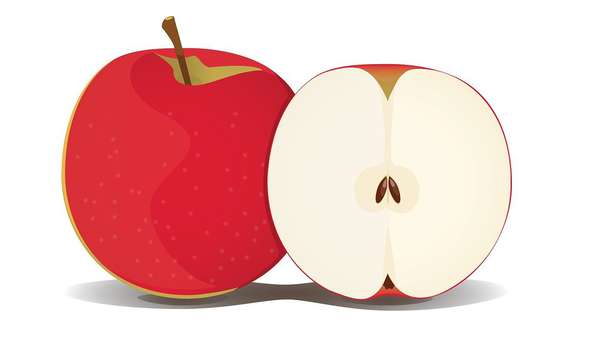

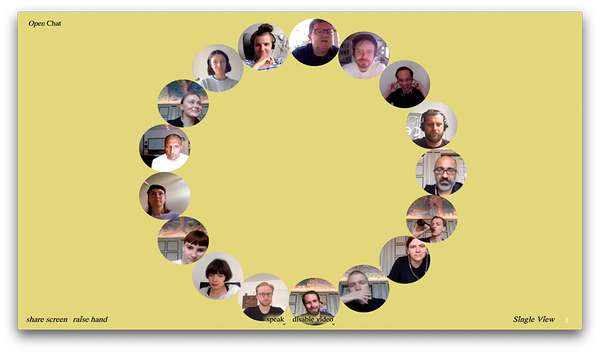
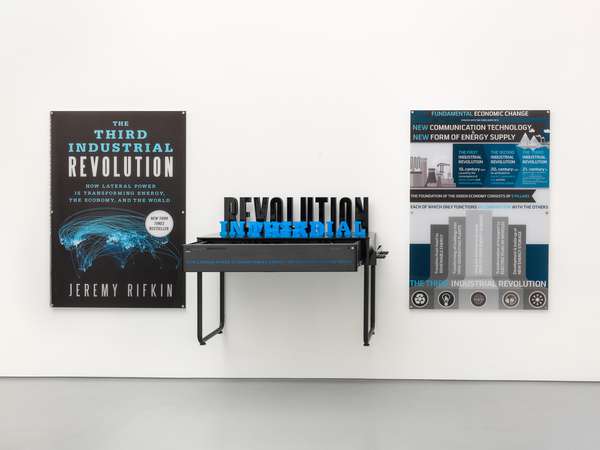











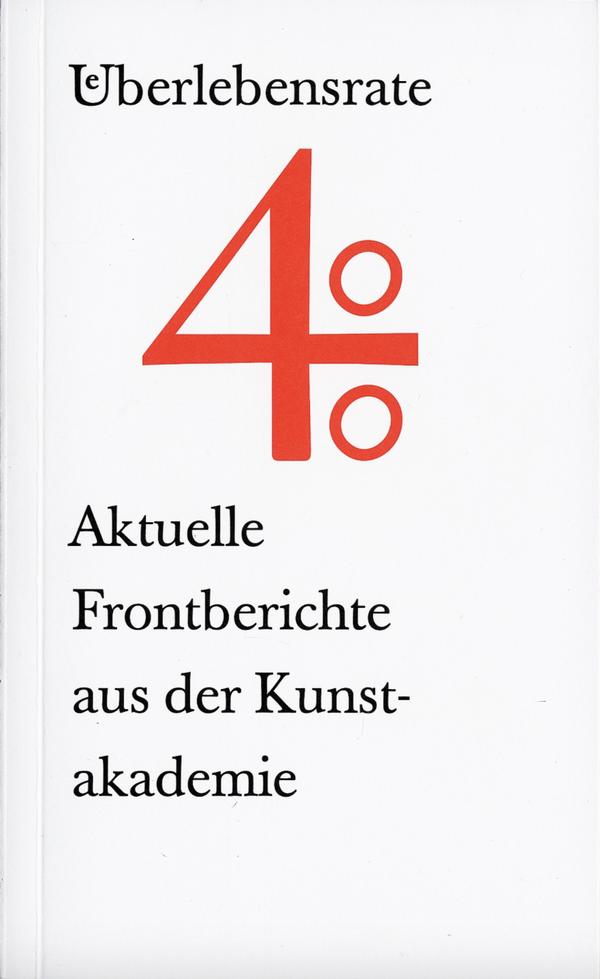


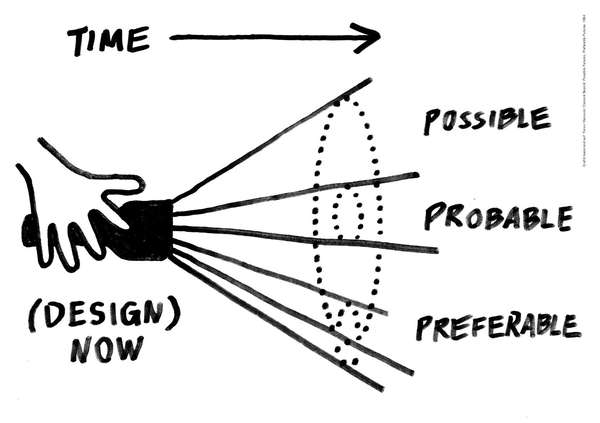
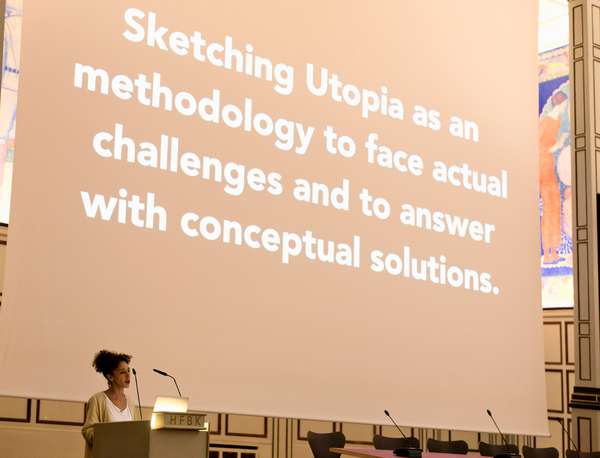
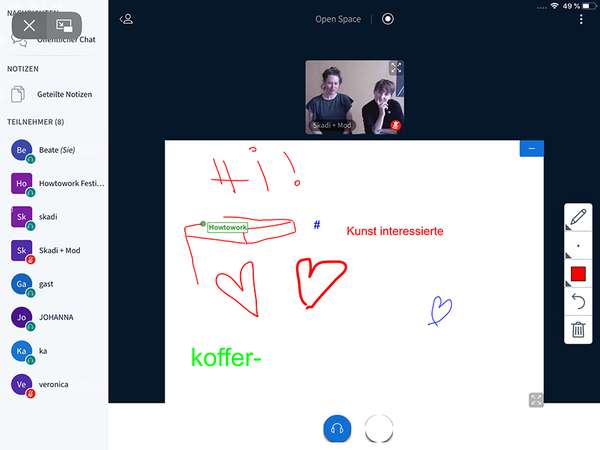

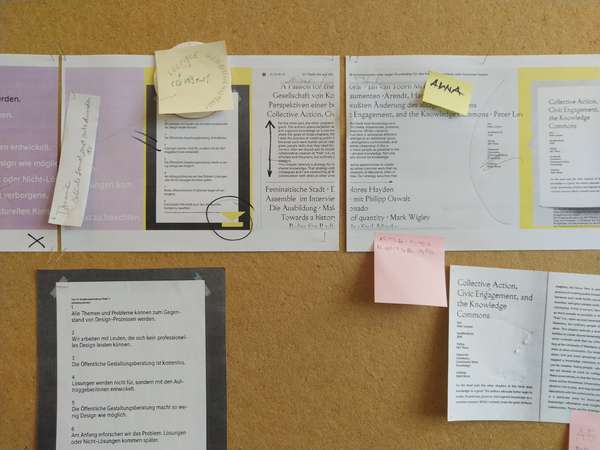
 Graduate Show 2025: Don't stop me now
Graduate Show 2025: Don't stop me now
 Lange Tage, viel Programm
Lange Tage, viel Programm
 Cine*Ami*es
Cine*Ami*es
 Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft
Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft
 Kunst im öffentlichen Raum
Kunst im öffentlichen Raum
 How to apply: Studium an der HFBK Hamburg
How to apply: Studium an der HFBK Hamburg
 Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg
 Der Elefant im Raum – Skulptur heute
Der Elefant im Raum – Skulptur heute
 Hiscox Kunstpreis 2024
Hiscox Kunstpreis 2024
 Die Neue Frau
Die Neue Frau
 Promovieren an der HFBK Hamburg
Promovieren an der HFBK Hamburg
 Graduate Show 2024 - Letting Go
Graduate Show 2024 - Letting Go
 Finkenwerder Kunstpreis 2024
Finkenwerder Kunstpreis 2024
 Archives of the Body - The Body in Archiving
Archives of the Body - The Body in Archiving
 Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa
Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa
 Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg
 (Ex)Changes of / in Art
(Ex)Changes of / in Art
 Extended Libraries
Extended Libraries
 And Still I Rise
And Still I Rise
 Let's talk about language
Let's talk about language
 Graduate Show 2023: Unfinished Business
Graduate Show 2023: Unfinished Business
 Let`s work together
Let`s work together
 Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg
 Symposium: Kontroverse documenta fifteen
Symposium: Kontroverse documenta fifteen
 Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image
Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image
 Einzelausstellung von Konstantin Grcic
Einzelausstellung von Konstantin Grcic
 Kunst und Krieg
Kunst und Krieg
 Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun
Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun
 Der Juni lockt mit Kunst und Theorie
Der Juni lockt mit Kunst und Theorie
 Finkenwerder Kunstpreis 2022
Finkenwerder Kunstpreis 2022
 Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule
Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule
 Raum für die Kunst
Raum für die Kunst
 Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg
 Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments
Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments
 Diversity
Diversity
 Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021
Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021
 Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen
Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen
 Schule der Folgenlosigkeit
Schule der Folgenlosigkeit
 Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg
 Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020
Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020
 Digitale Lehre an der HFBK
Digitale Lehre an der HFBK
 Absolvent*innenstudie der HFBK
Absolvent*innenstudie der HFBK
 Wie politisch ist Social Design?
Wie politisch ist Social Design?