Promotionsvorhaben Martin Wiesinger
Arbeitstitel: Die Kreuzigungsdarstellung des Juan de la Cruz
Betreuung: Prof. Bettina Uppenkamp, Prof. Kristin Marek
Johannes vom Kreuz (um 1540 - 1591), dessen bürgerlicher Name Juan de Yepes lautete, war Karmelit, ein Wegbegleiter der Teresa von Ávila und er gilt als eine der wichtigsten Figuren der spanischen Mystik sowie der spanischsprachigen Poesie der Frühen Neuzeit.
Im Blick auf den Umfang seiner poetischen und prosaischen Texte mutet eine von ihm angefertigte Tuschezeichnung, die gerade einmal 6,4 mal 5,1 Zentimeter misst, eher unscheinbar an. Es handelt sich jedoch bei dieser Zeichnung um eine Kreuzigungsdarstellung, deren Besonderheit sich nicht zuletzt durch eine Perspektive auszeichnet, die ihresgleichen sucht: Sie zeigt Jesus am Kreuz von einem deutlich erhobenen Standpunkt in einer Schräge, welche die herkömmliche kompositorische Fokussierung frontal auf das Kreuz hin außer Kraft setzt. Es scheint an keinem Punkt der christlichen Ikonographie eine vergleichbare Verschiebung des Betrachtungsstandpunktes gegeben zu haben. Sieht man den Gekreuzigten aus der Sicht Gottes?
Durch die räumliche Verortung des Menschen in seiner Relation zum Göttlichen lassen sich Theologien und metaphysische Modelle nachvollziehbar äußern. Die Betrachtung dieser Zeichnung kann hierbei als Veranschaulichung eines theologischen und damit auch bildtheoretischen Kommentars von großem Gewicht besprochen werden.
1453 ließ Nikolaus von Kues seine Glaubensbrüder vom Tegernsee sich im Halbkreis vor einer Ikone aufstellen. Das gemalte Antlitz blickte jeden von ihnen individuell und im gleichen Moment alle auf einmal an. Es folgte ihrem Blick, wenn sie den Raum vor dem Bild durchschritten. Und vor allem: Die Mönche konnten sich dieser paradoxen Eigenschaften des Bildes nur vergewissern, wenn sie im Gespräch einander das glaubten, was sie sich sagten („Siehst Du das auch? Wirst Du auch angeblickt?“). Die Blickkonstellationen erlaubten es Nikolaus von Kues, die Besonderheit des Bildes als Zeichen einer göttlichen Überschreitung von unvereinbaren Widersprüchen auszulegen und gleichzeitig die ethische Dimension der Bildbetrachtung hervorzuheben.
Die Zeichnung von Johannes vom Kreuz ist ein Bild vom Bild dessen, was nicht abgebildet werden kann, gesehen mit den Augen dessen, was nicht abgebildet werden kann. Was bedeutet es, diesem ganz Anderen - Gott - ein solch menschliches Auge zu geben und ihn der Kreuzigung als Ereignis der Verbildlichung in seiner Ausweglosigkeit beiwohnen zu lassen? Was hat das mit unserem Blick auf die Erde und den Menschen „von oben“ zu tun - einem Blick, der seit dem Schritt in den Weltraum photographisch sichtbar wurde, aber schon mit dem Wunsch des kartographischen Überblicks die außerweltliche Sichtweise einführte? Und was bedeutet es, wie der zeichnende Blick des Johannes vom Kreuz die herkömmliche Erzählung von sehendem Subjekt und gesehenem Objekt zu verlassen und für einen umkreisenden Moment mit dem Auge der*s Anderen zu sehen, die/der nicht sichtbar werden kann oder nicht sichtbar werden möchte? Ist es möglich, anhand der Zeichnung die zwangsläufige Verbindung von Erscheinen und Sein zugunsten einer Differenz aufzugeben, die sich einer sich tilgenden Gleichung entzieht?
Zur Person:
- *1987 in Schwandorf / Deutschland
- 2011-2017 Studium der bildenden Kunst an der HfBK Dresden
Kontakt:






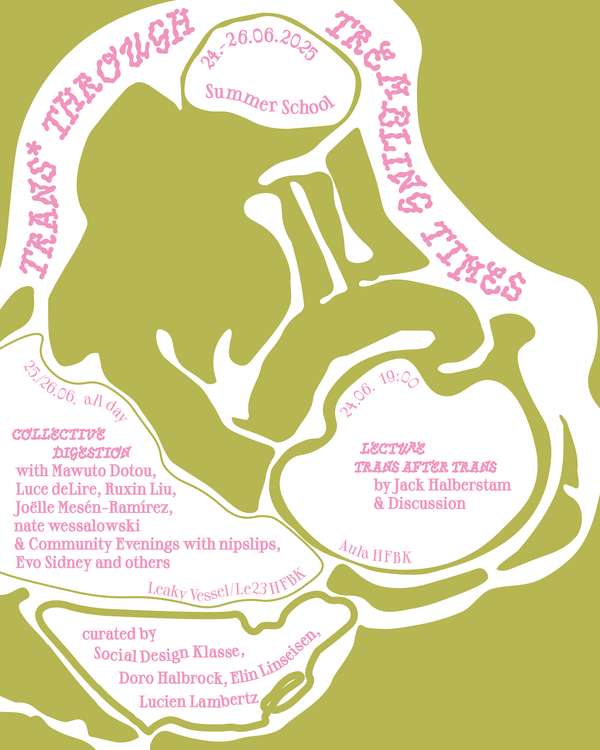





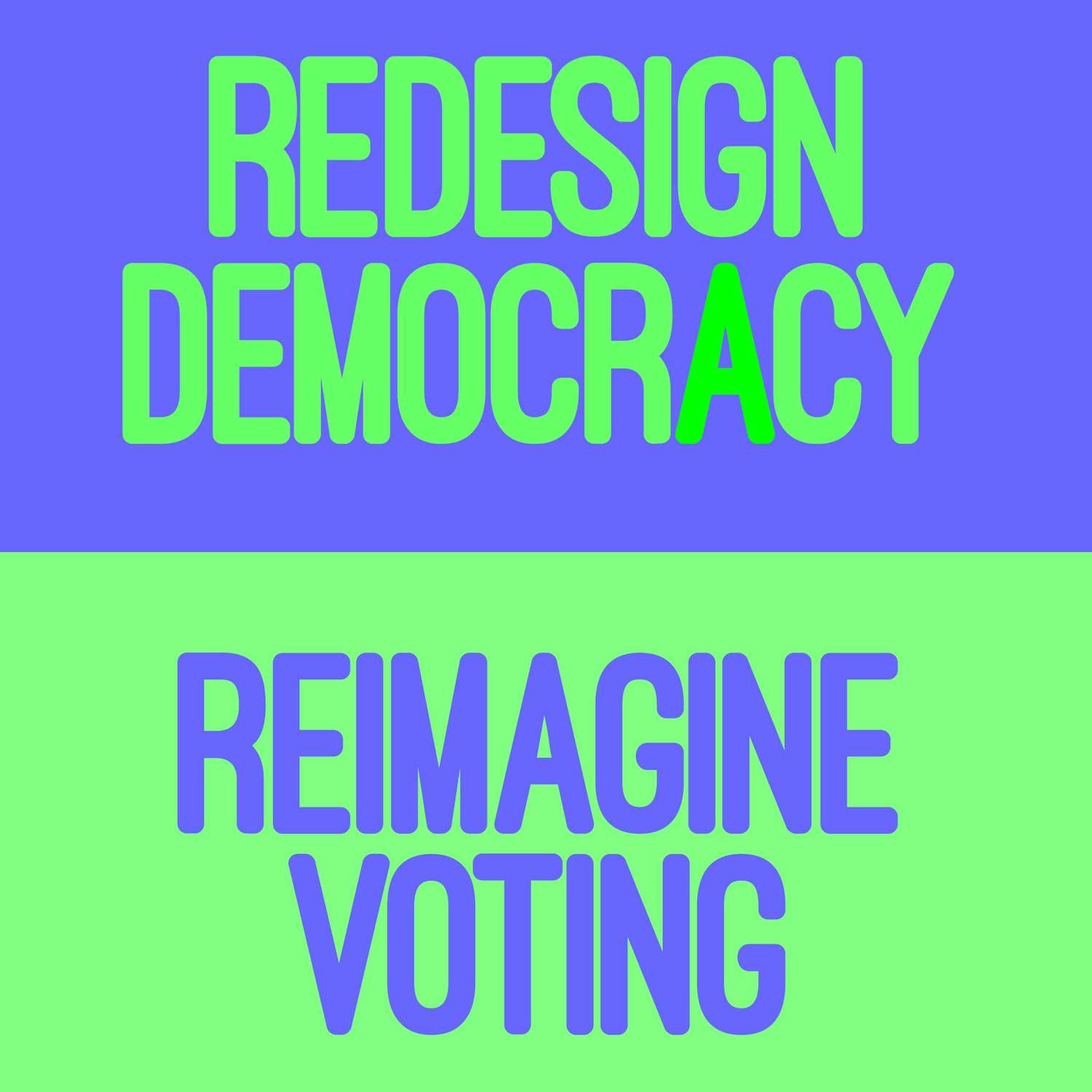











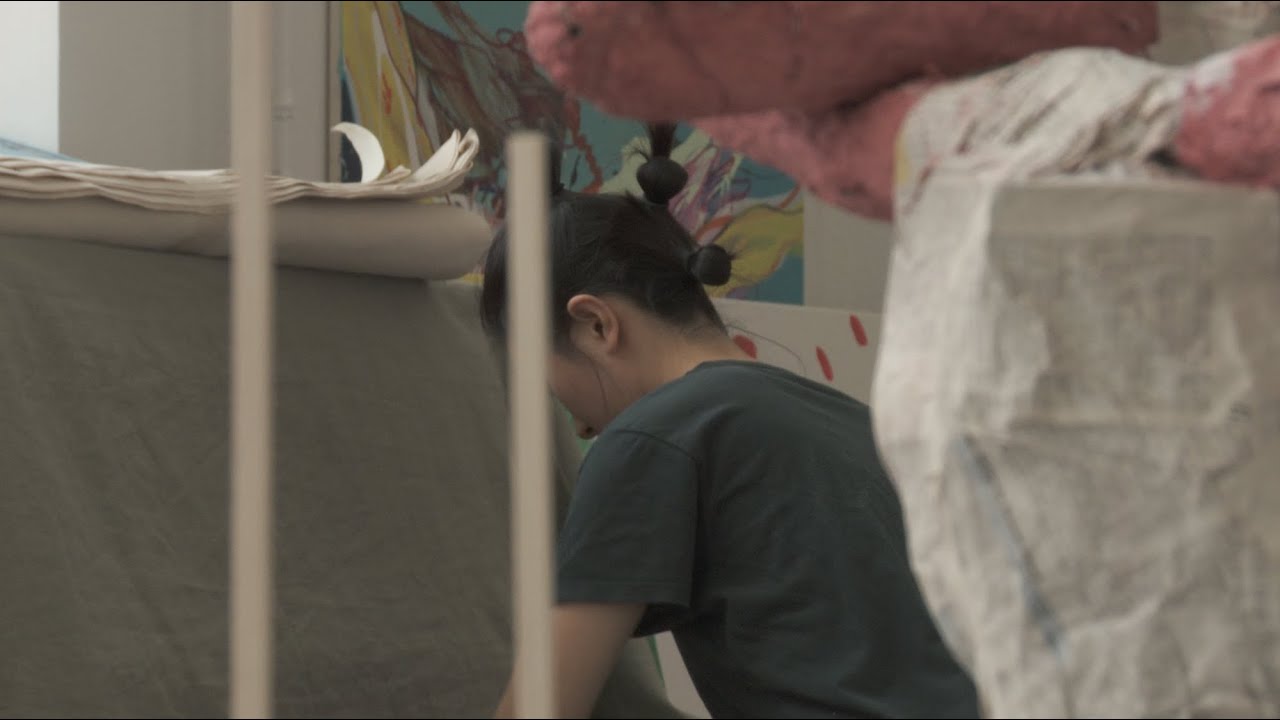






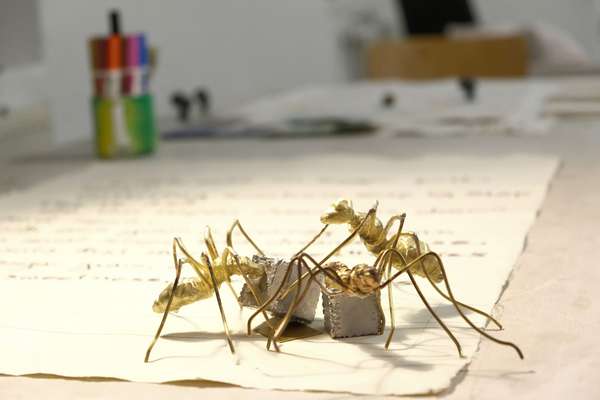



















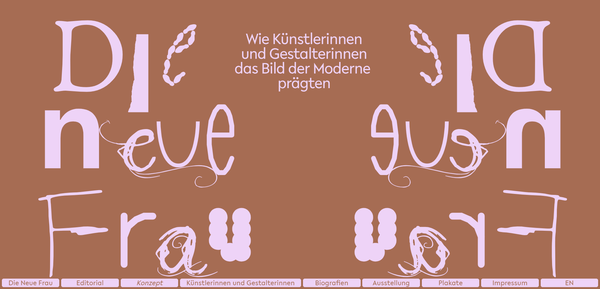
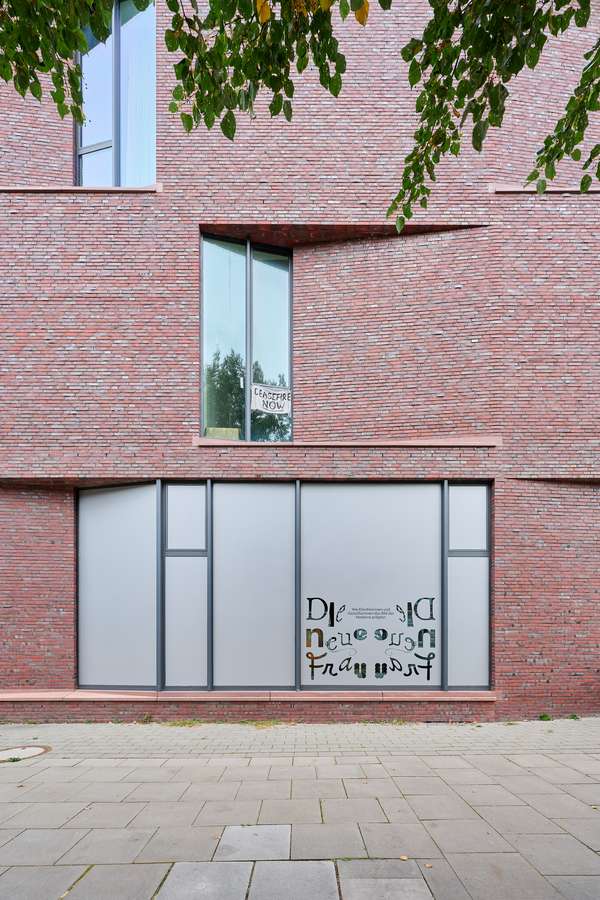



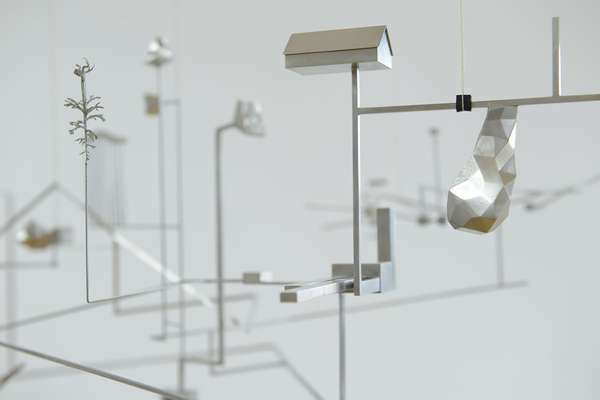











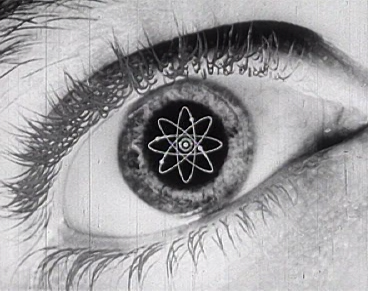
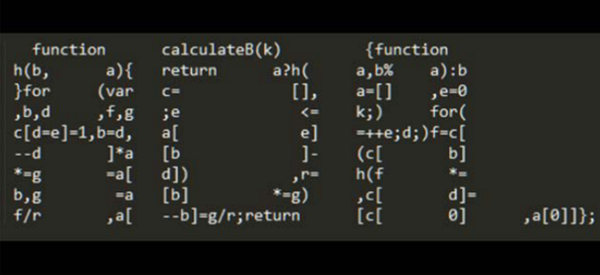
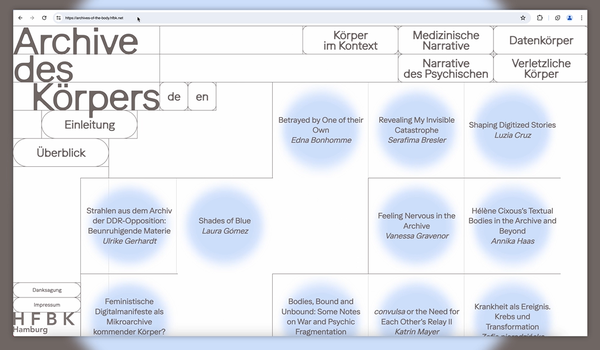
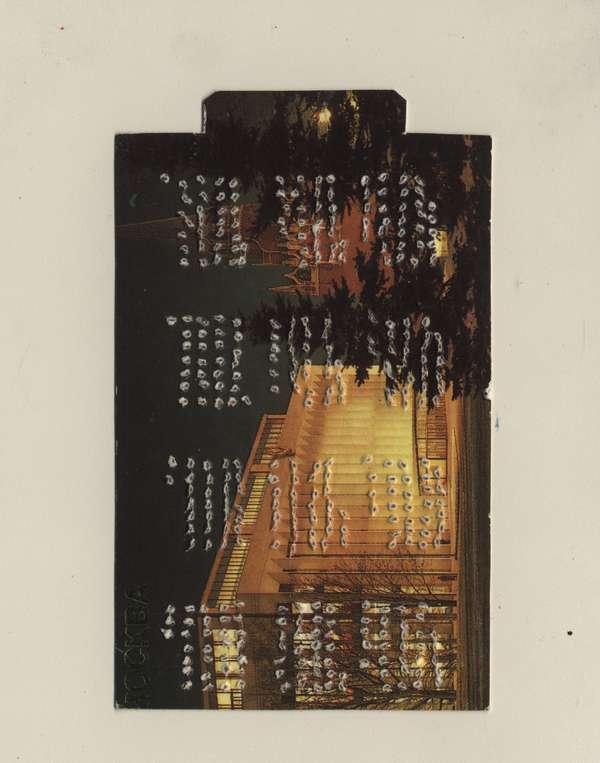
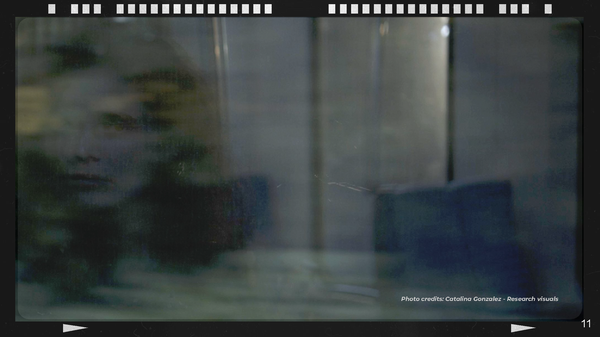



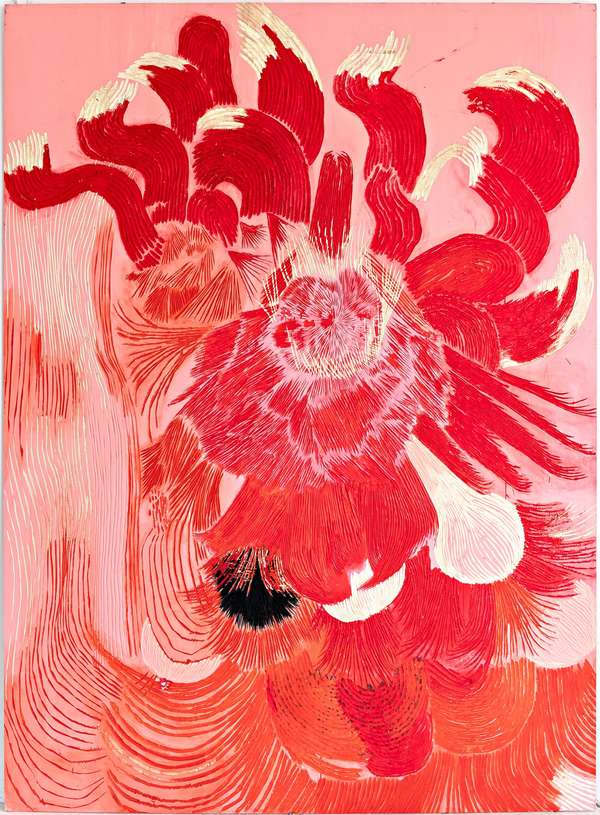







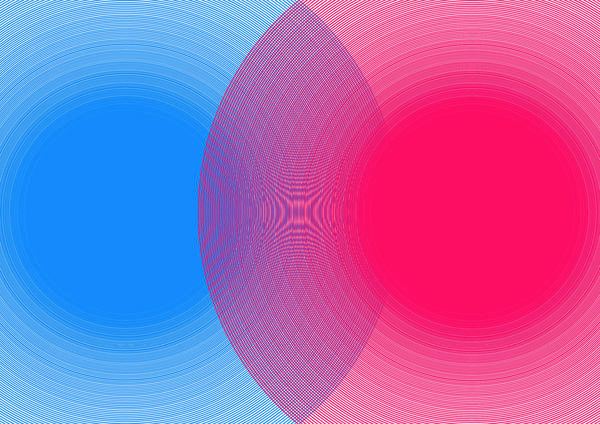






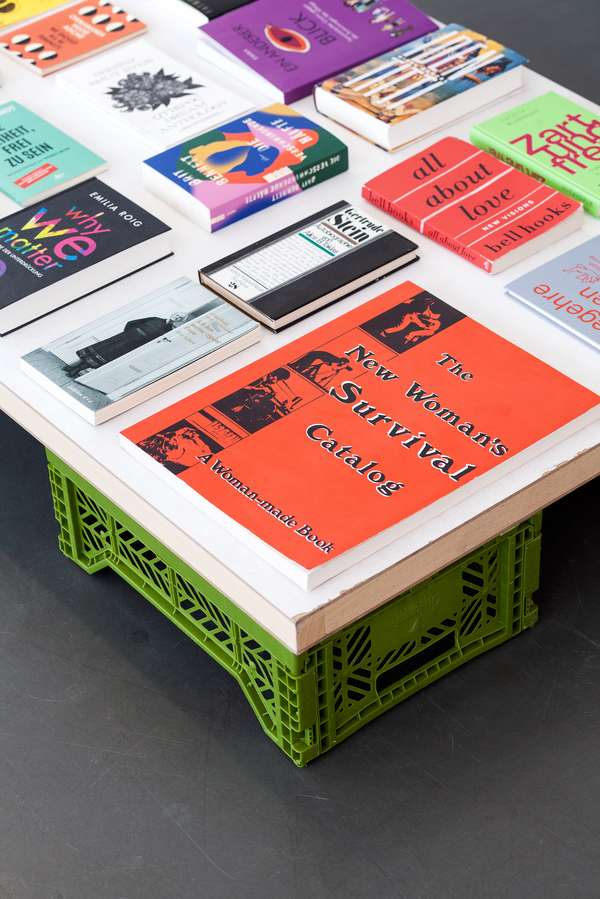



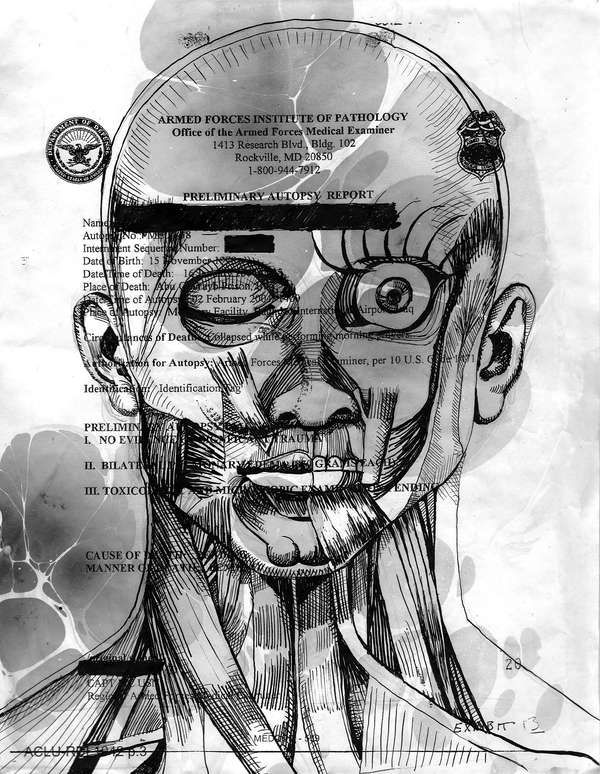

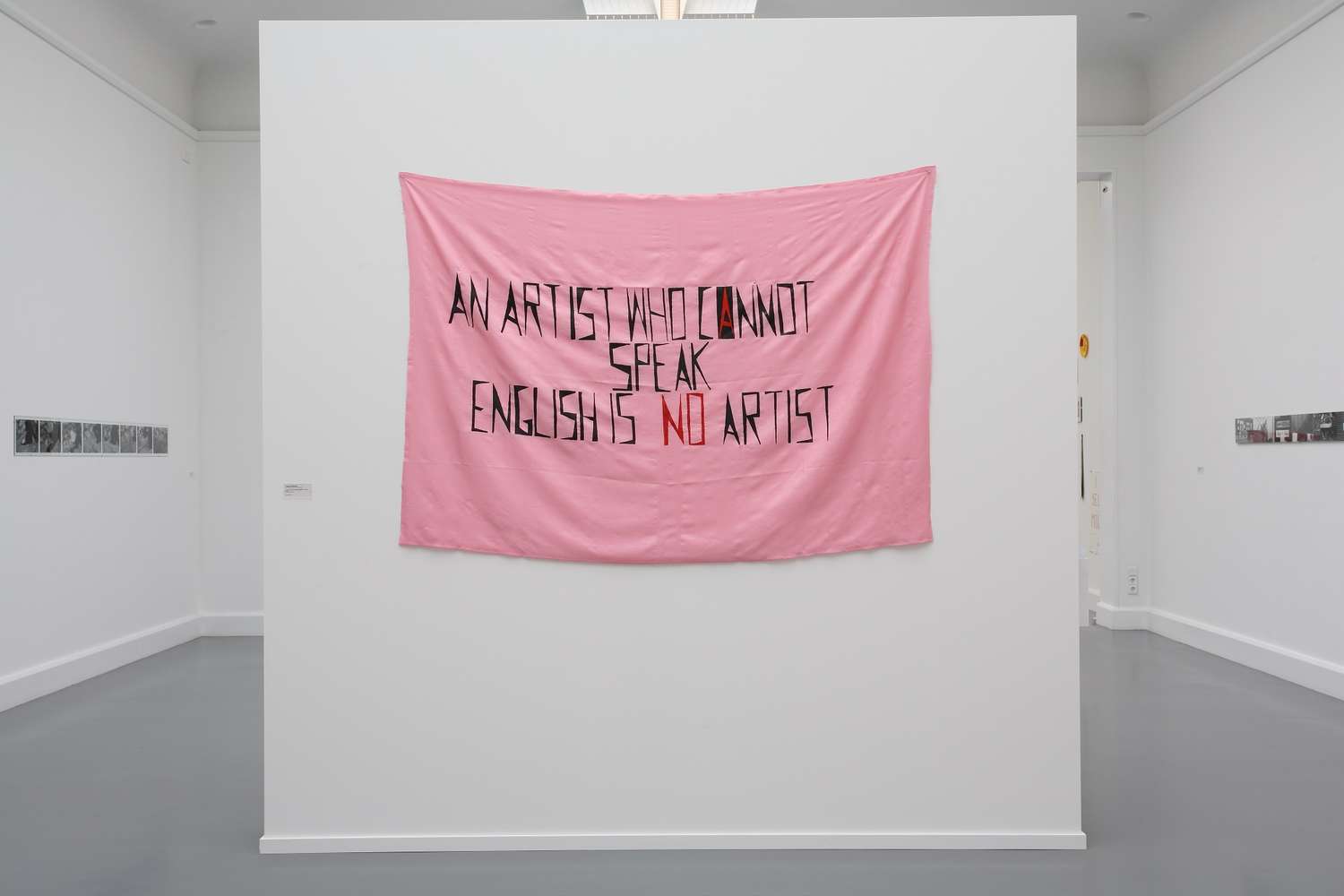

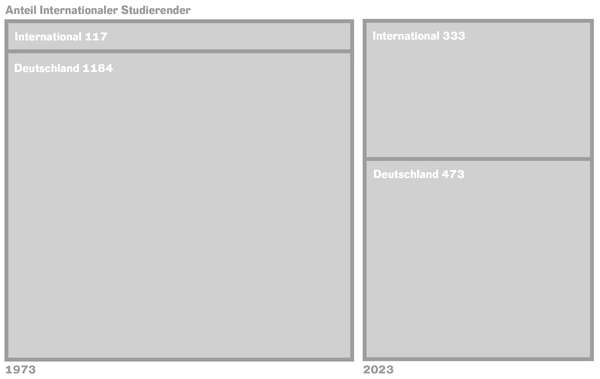
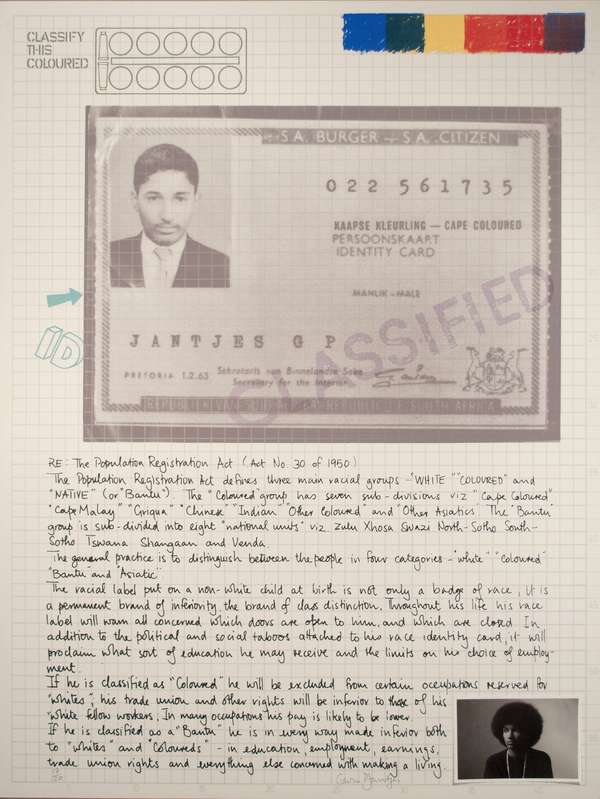
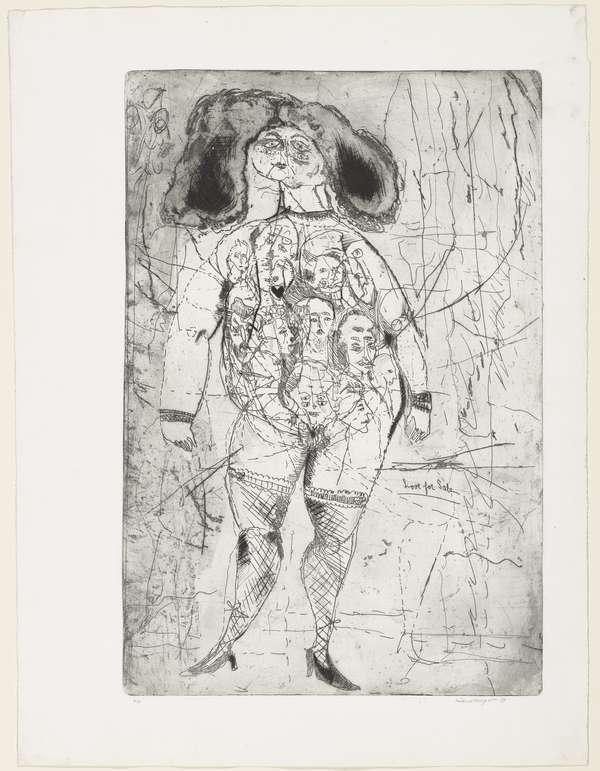
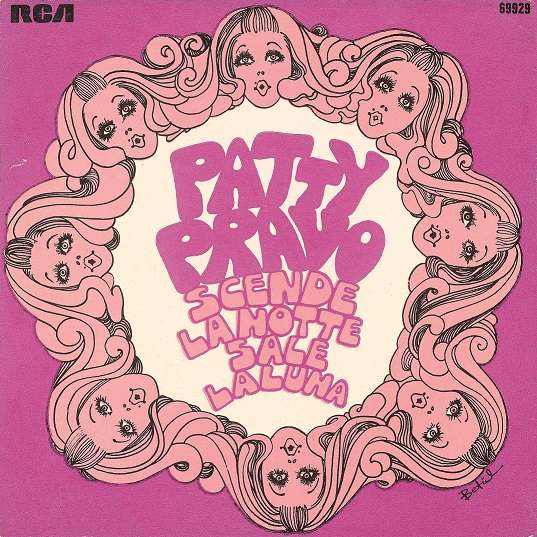





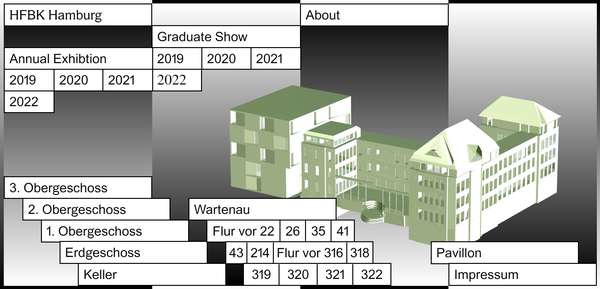
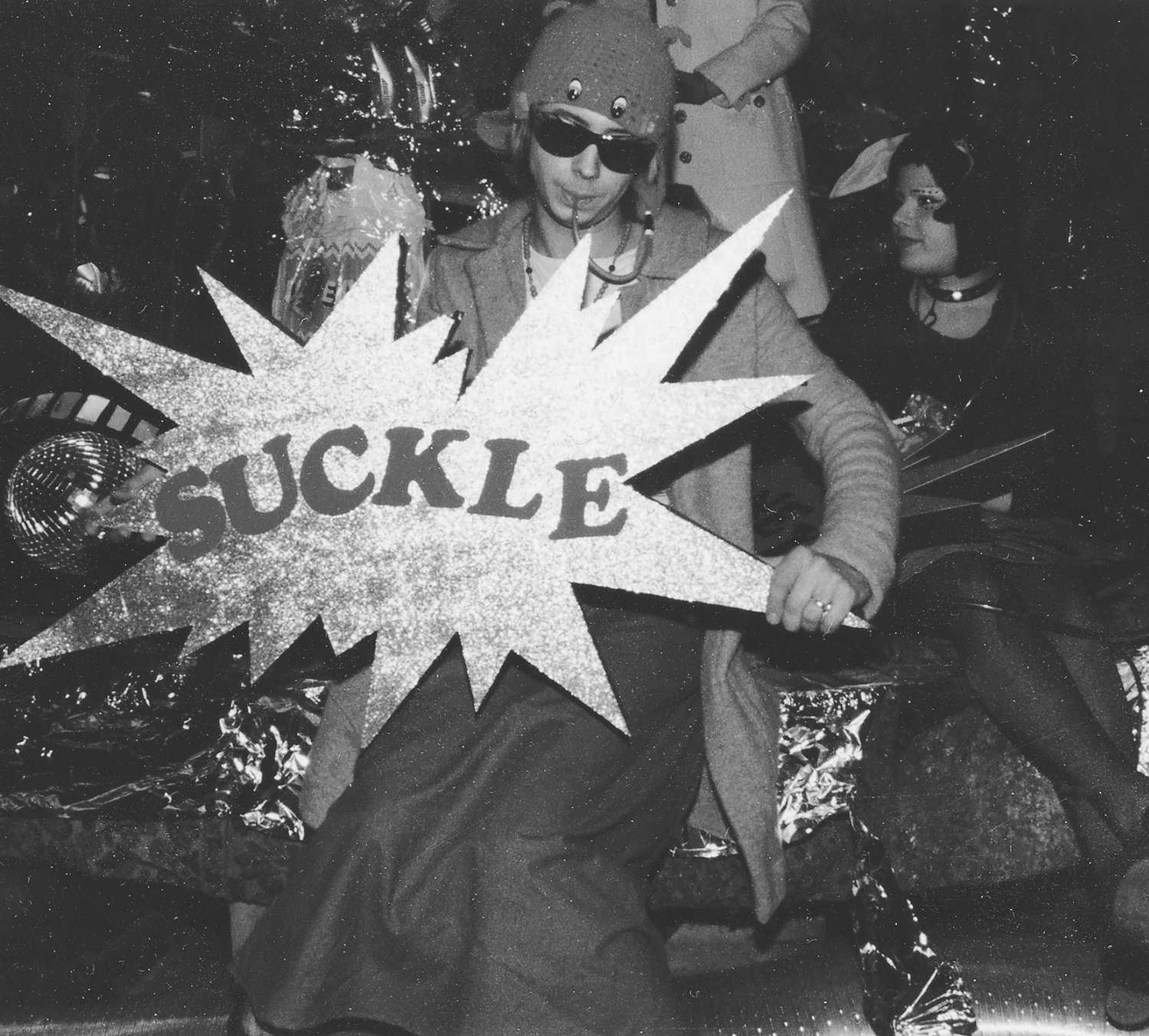



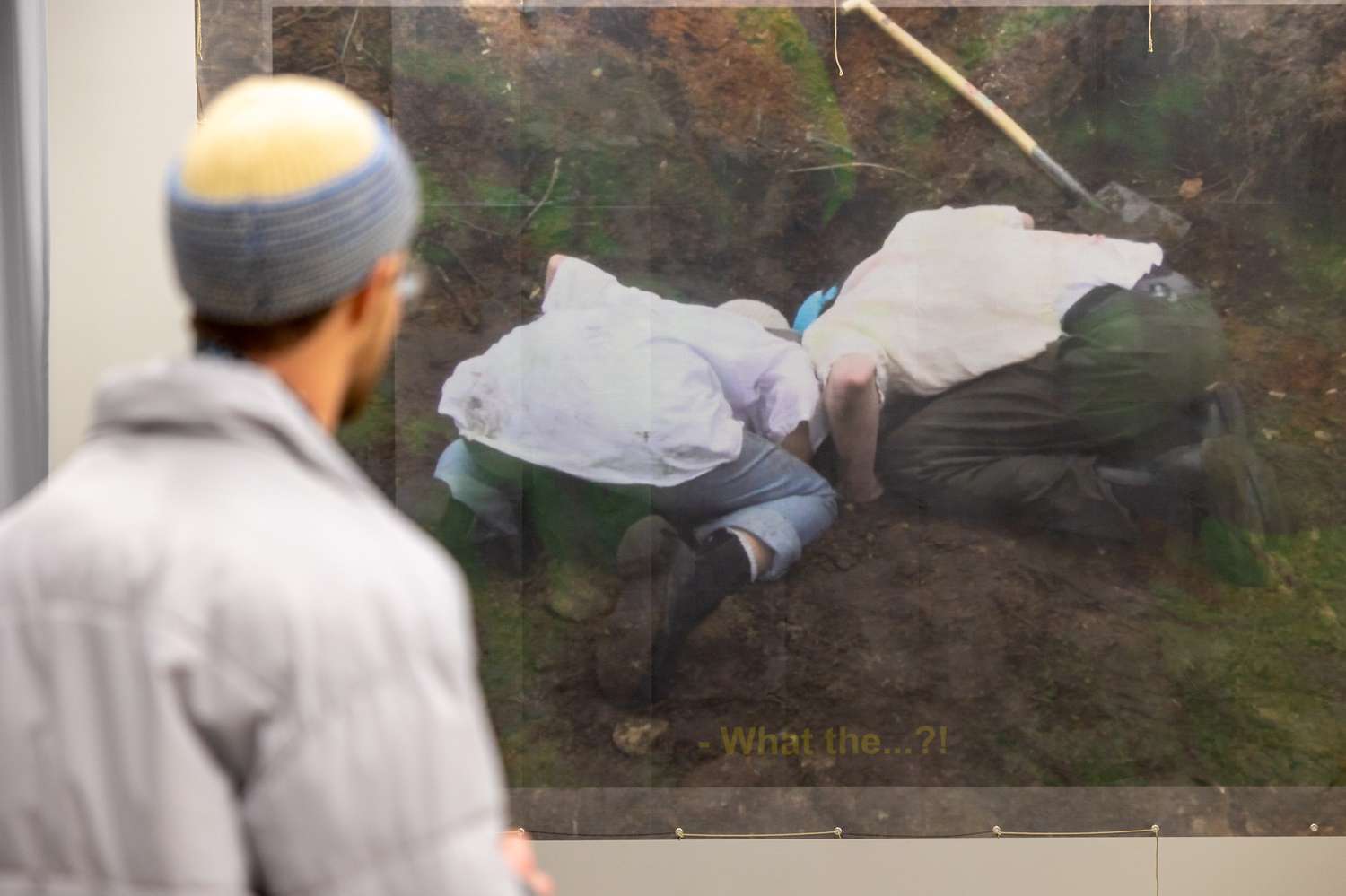


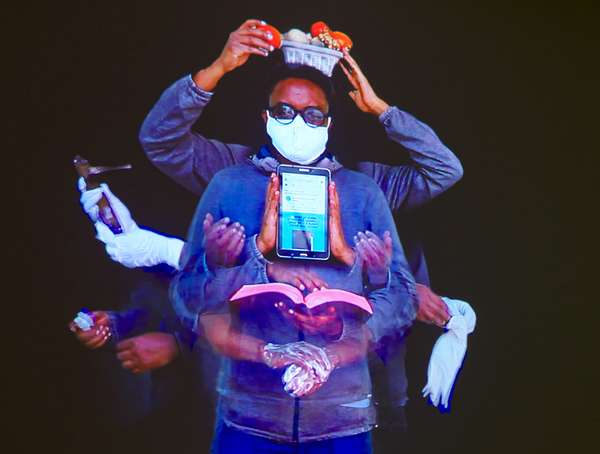
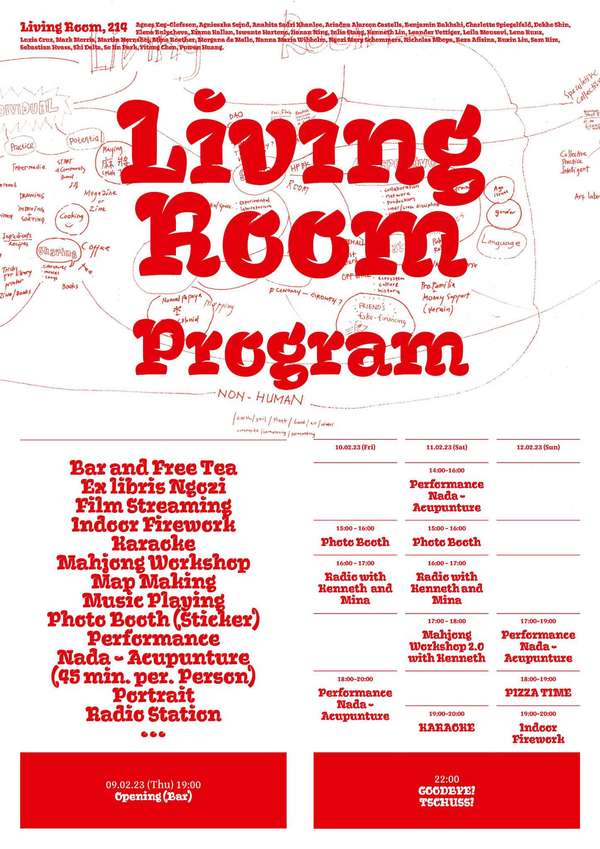
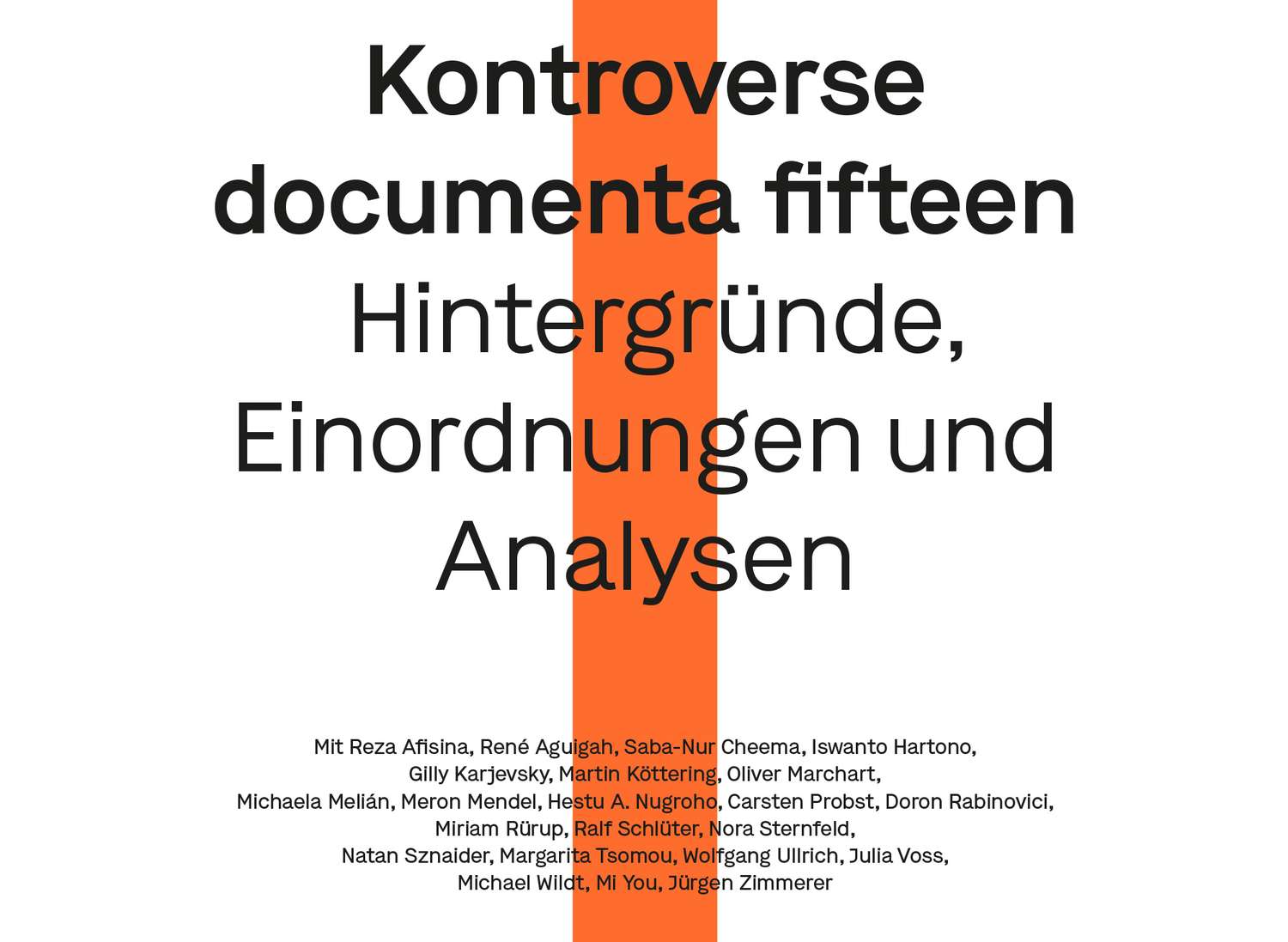




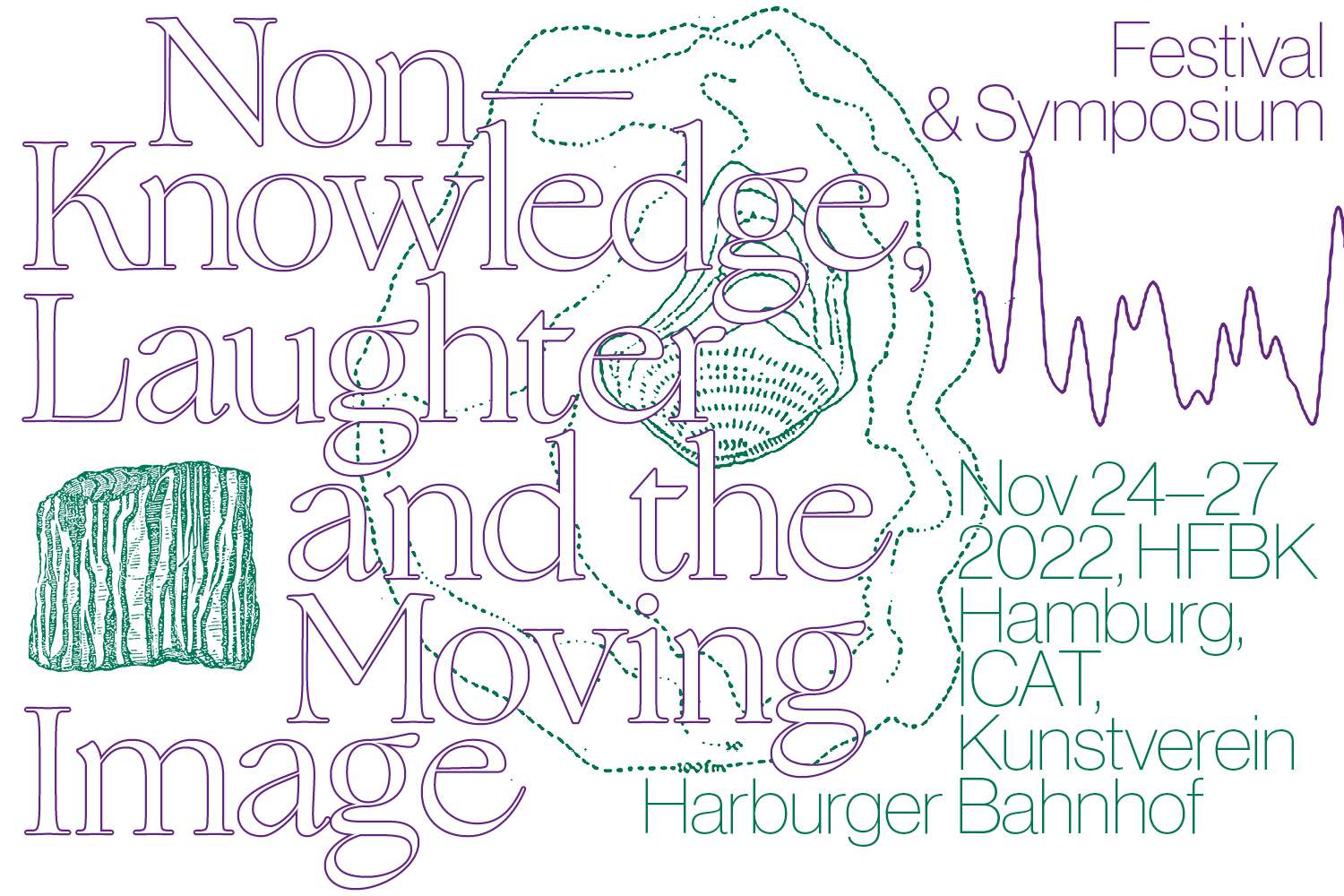









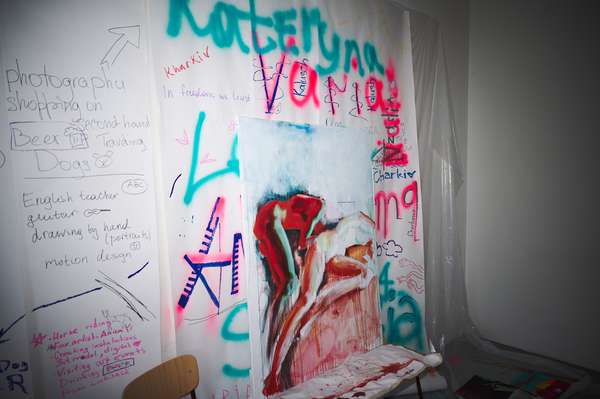




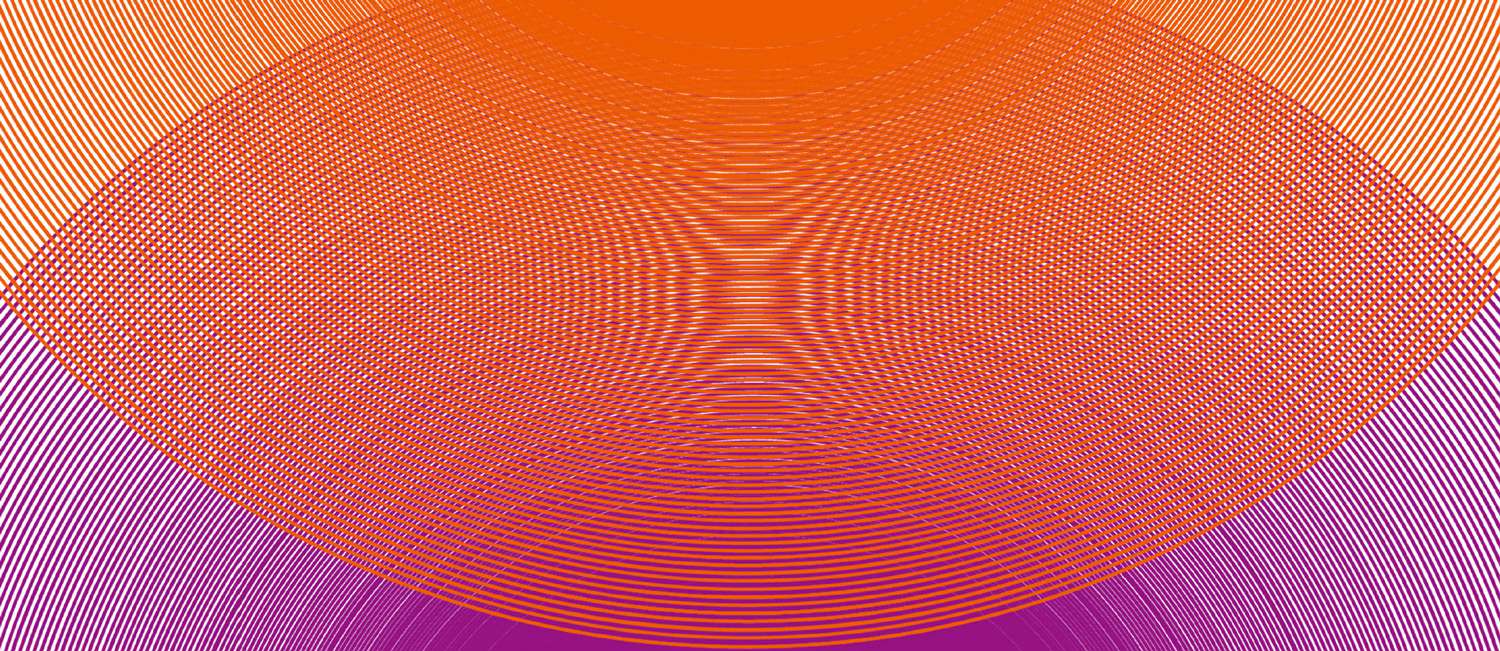
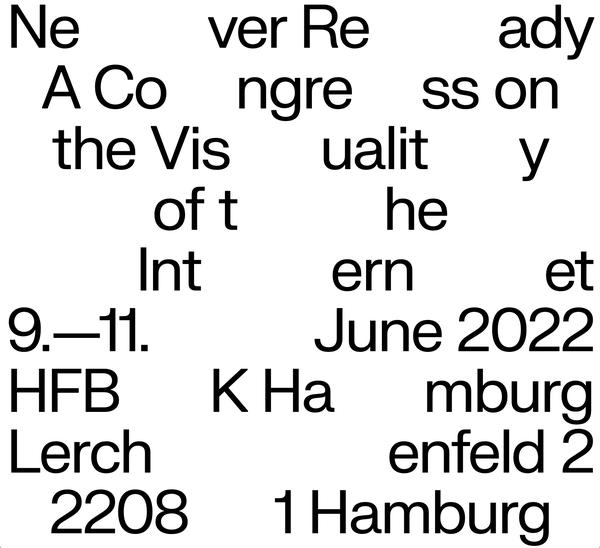
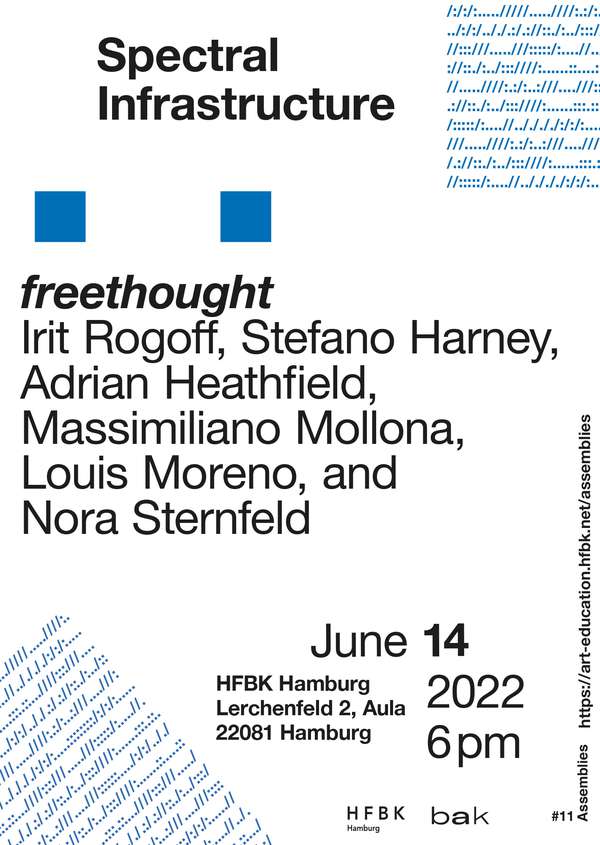

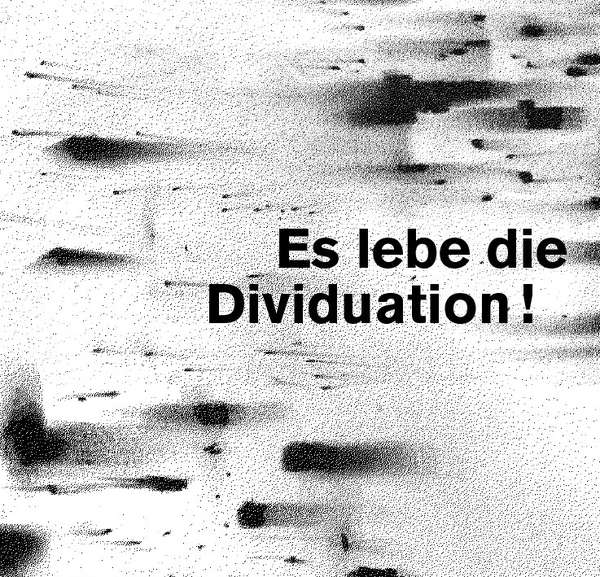
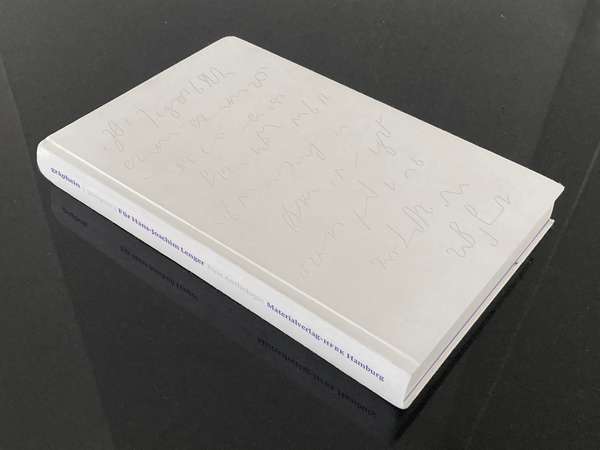
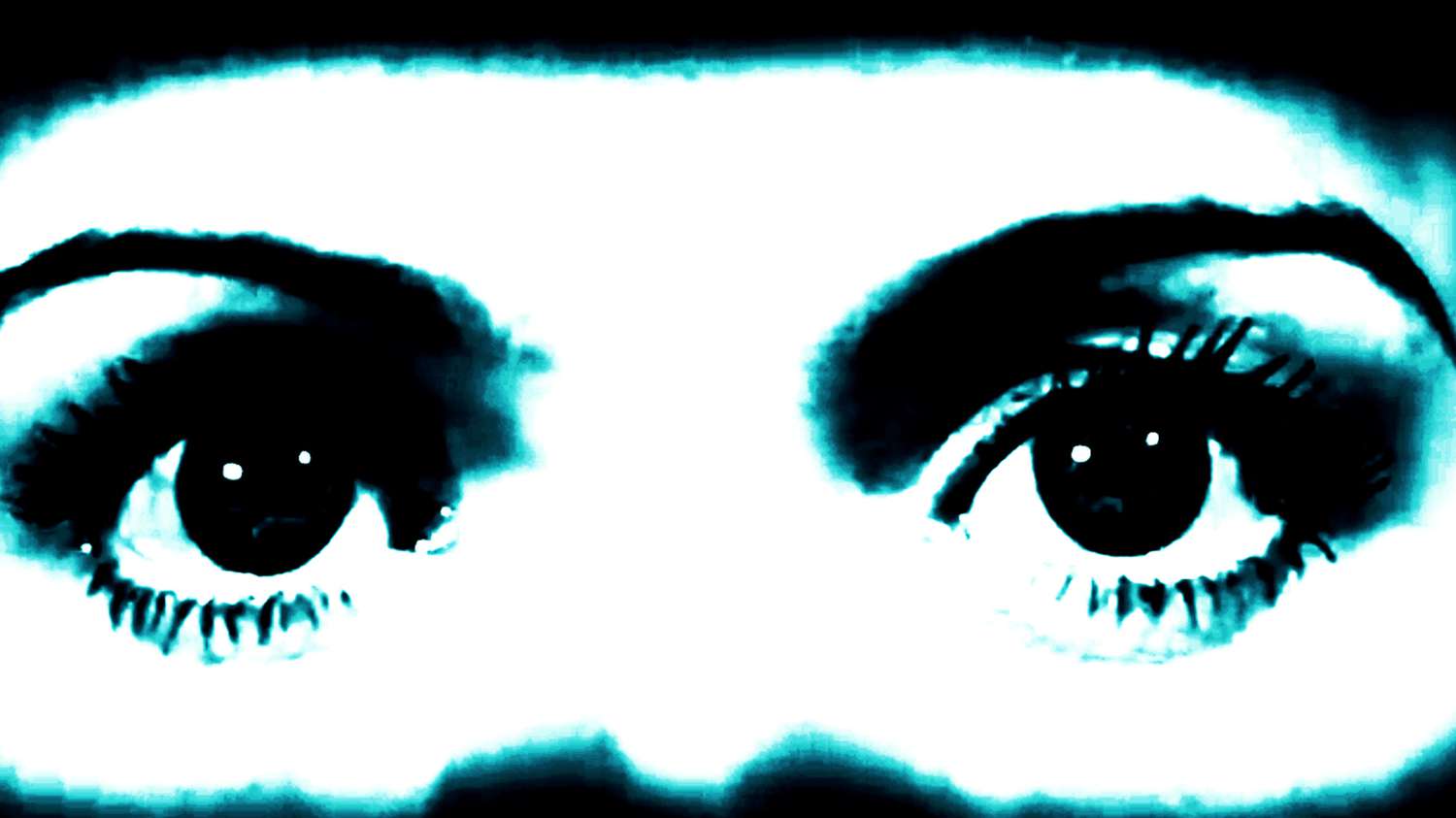
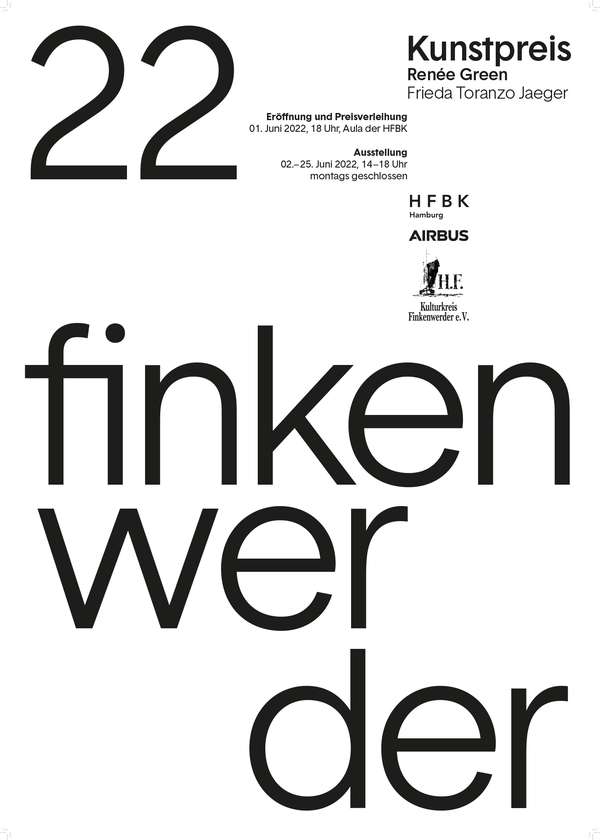















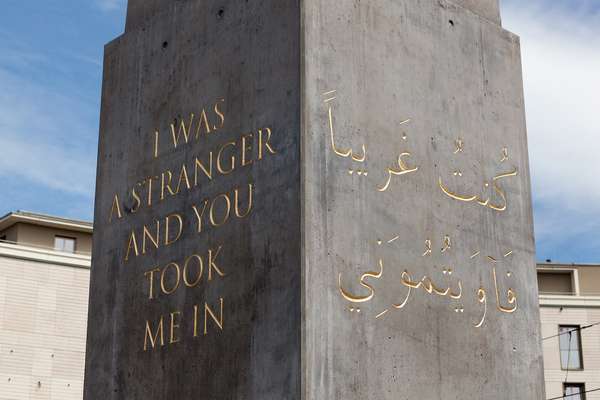
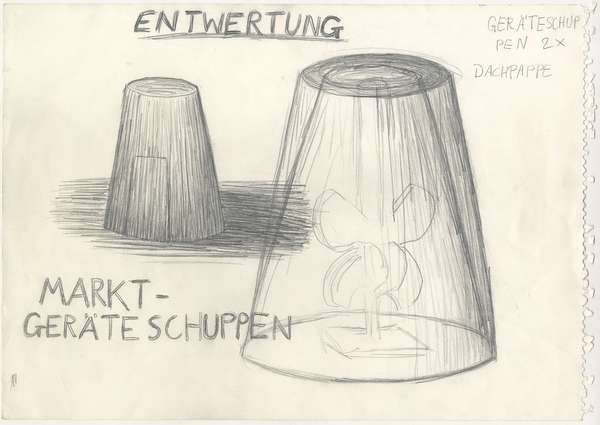
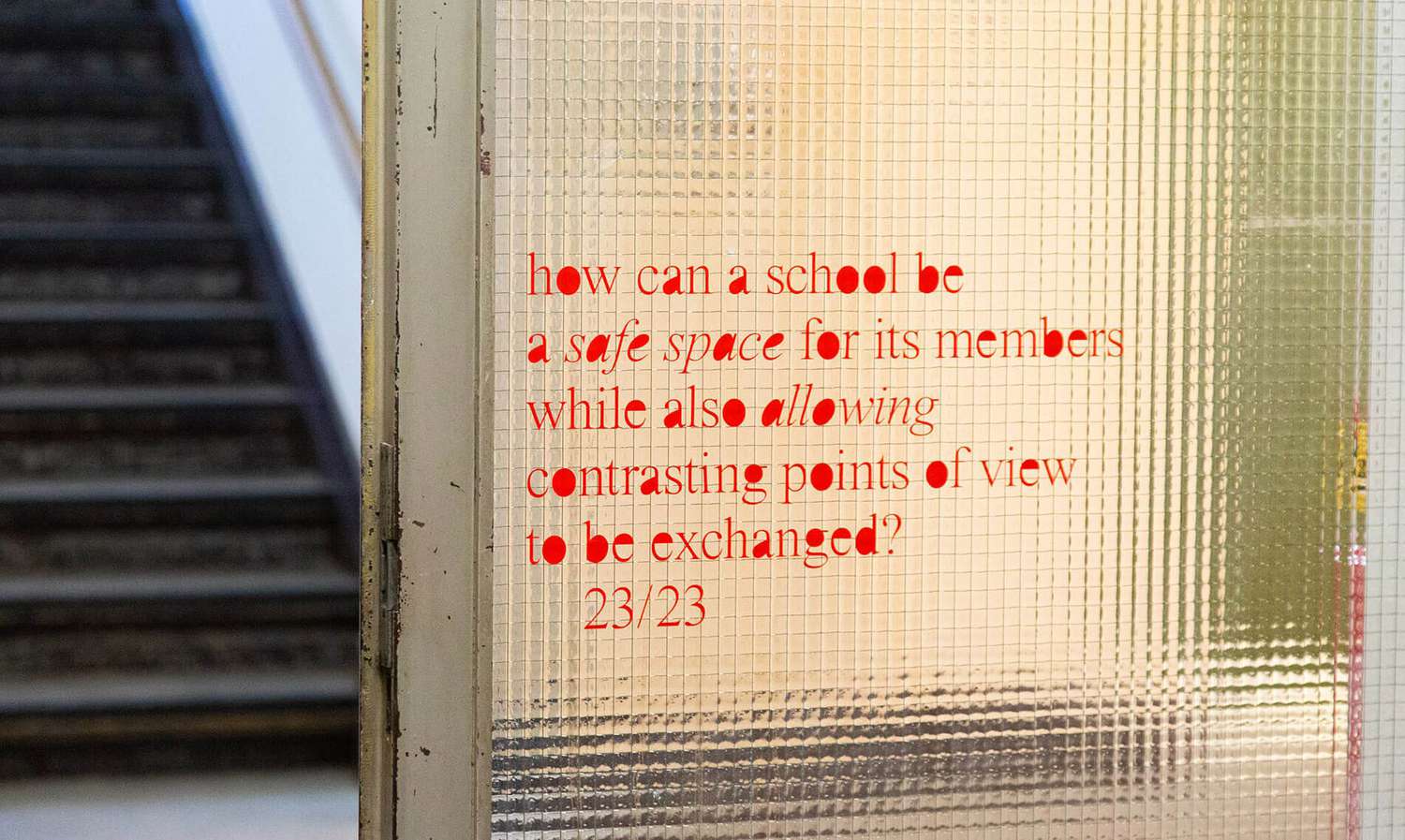

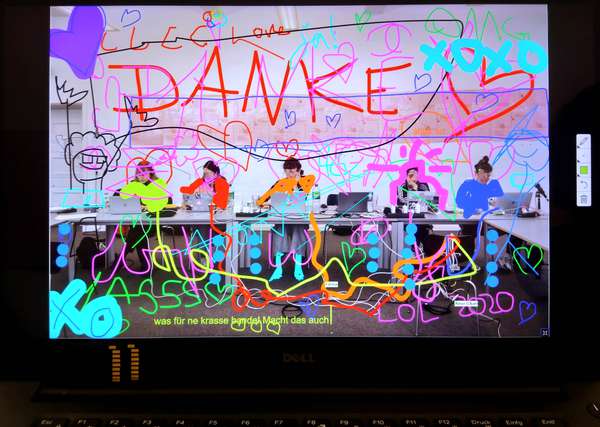
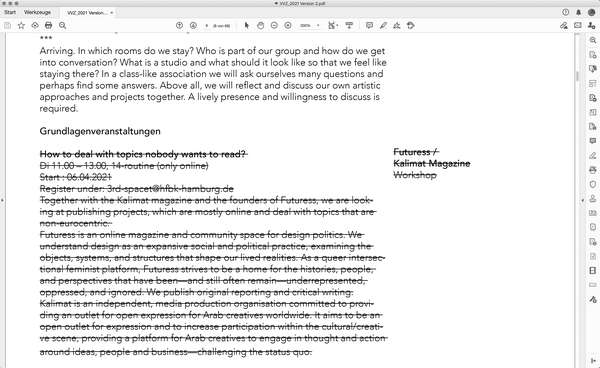
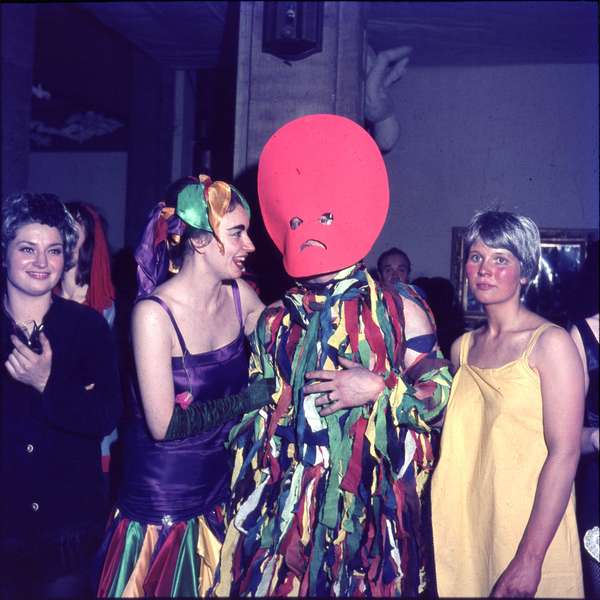





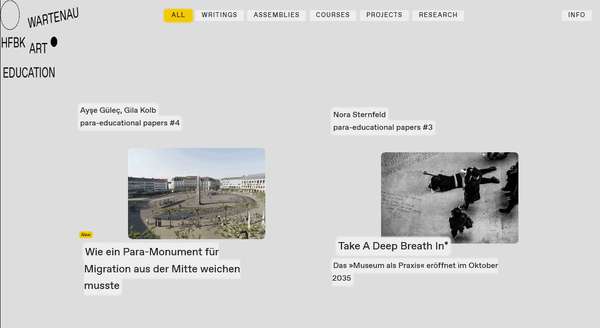

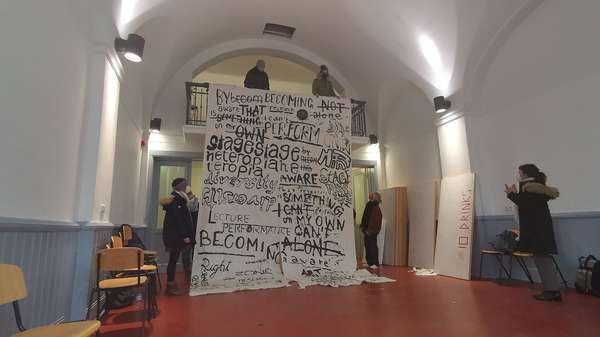
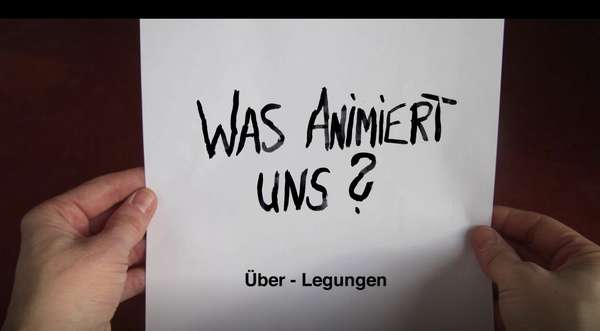





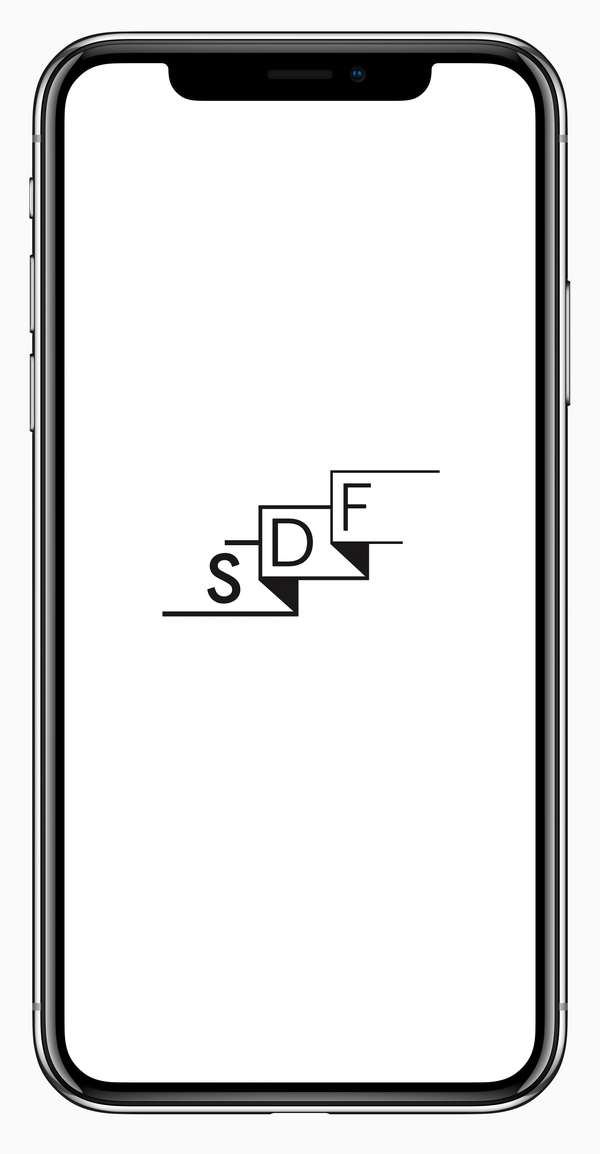
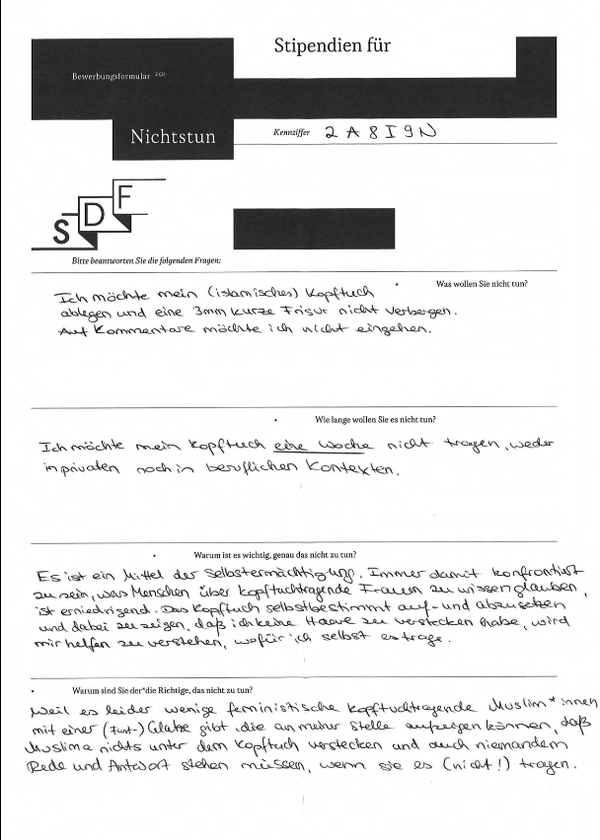


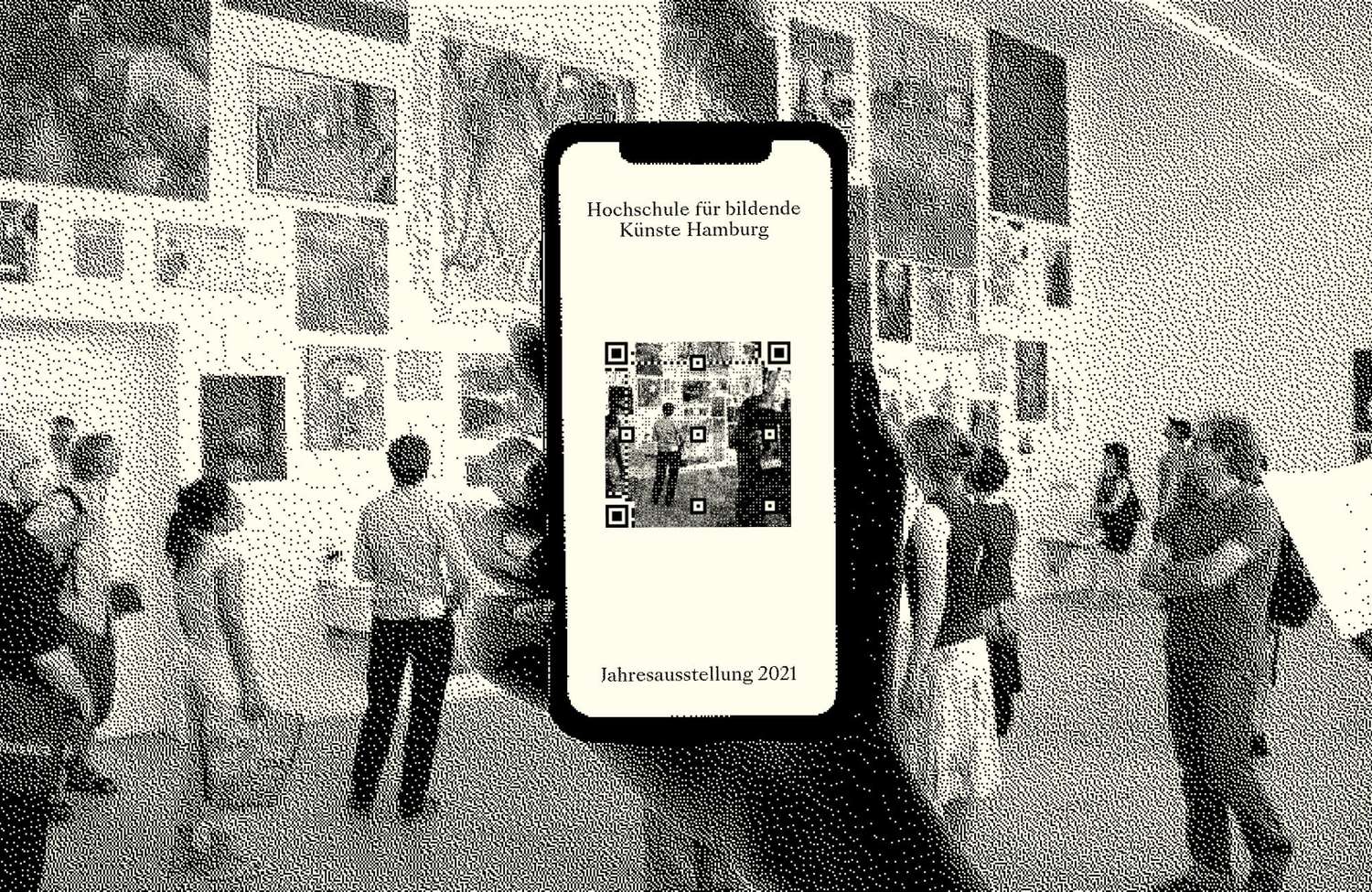

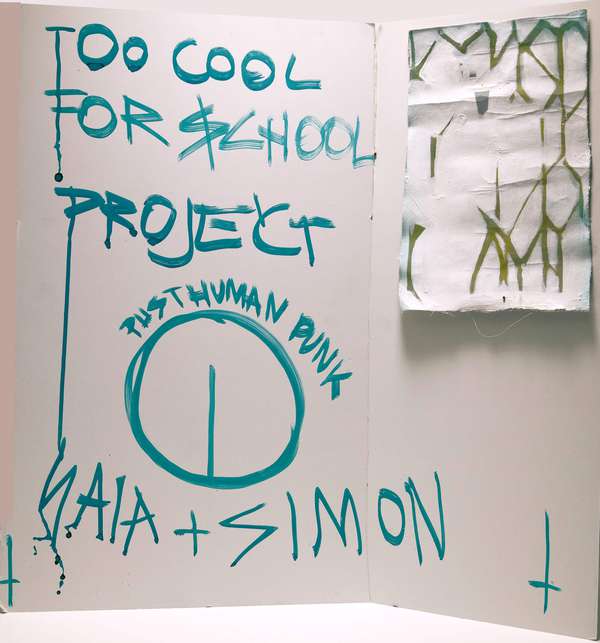

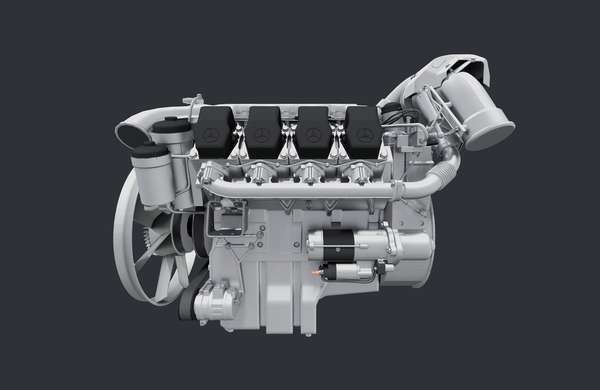





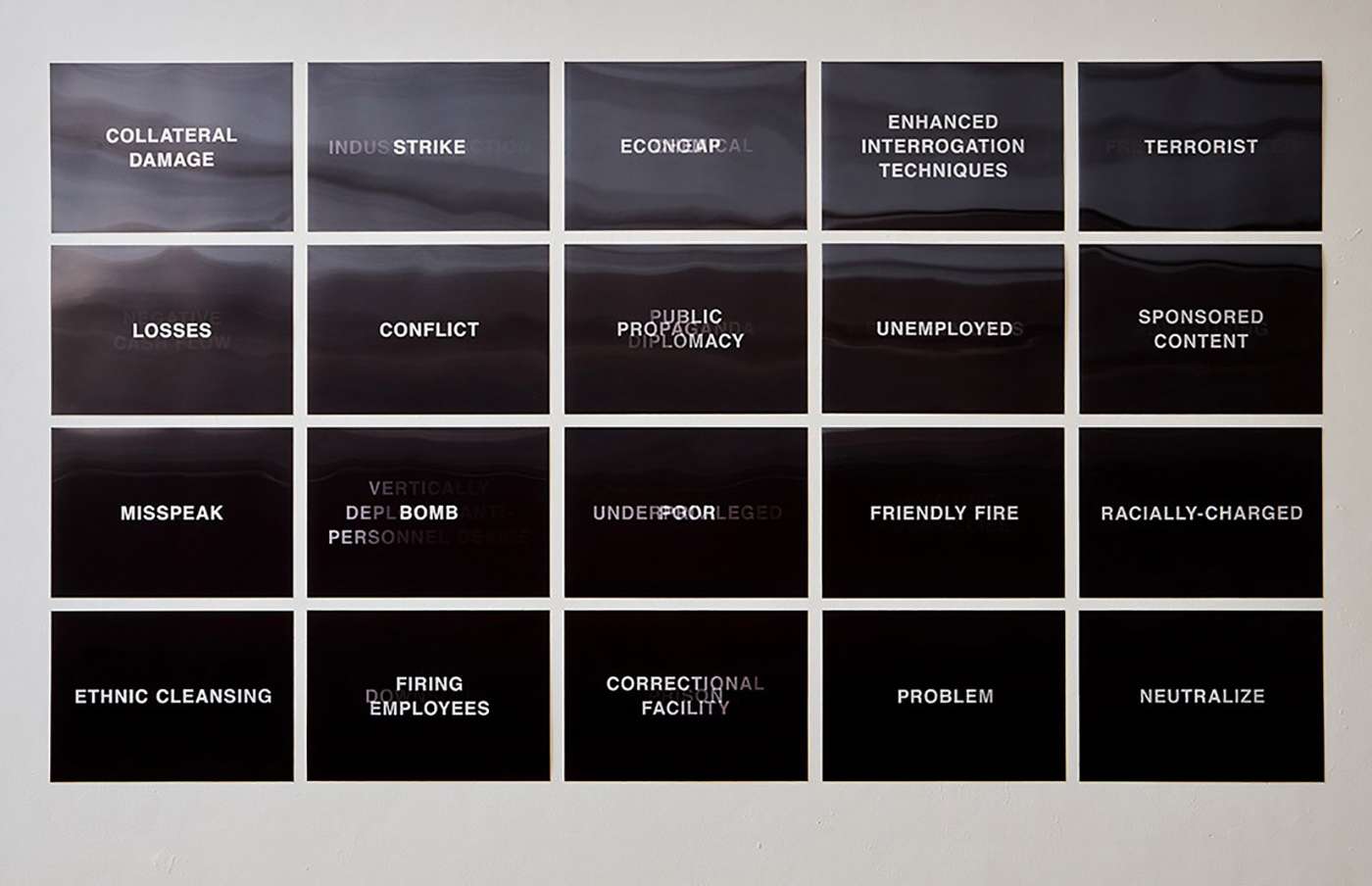




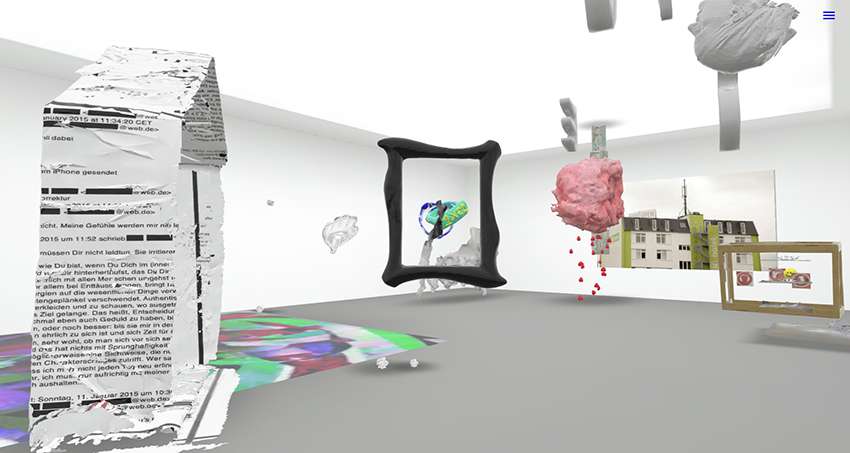
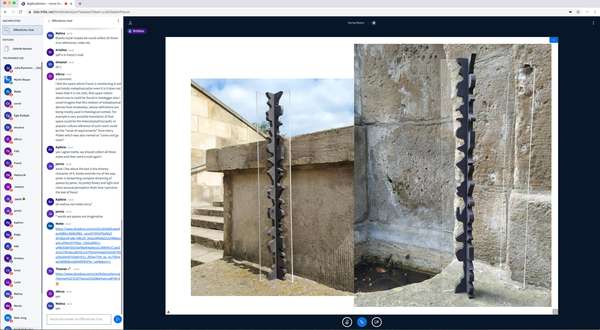
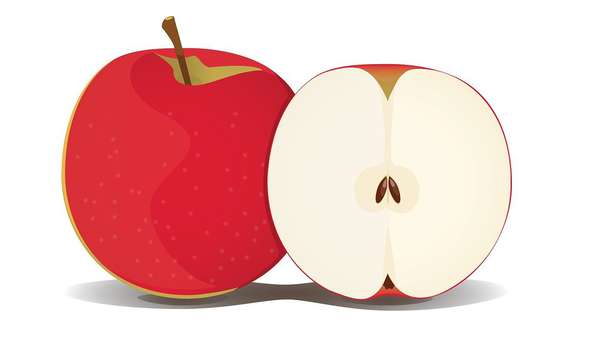

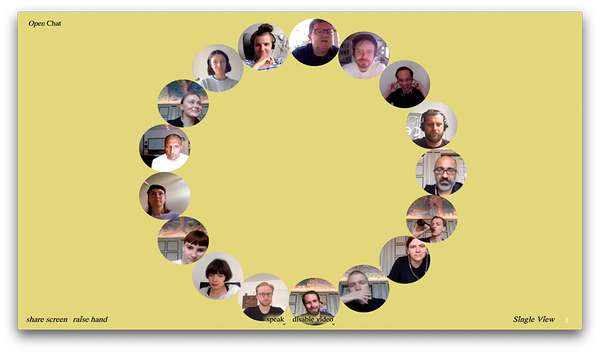
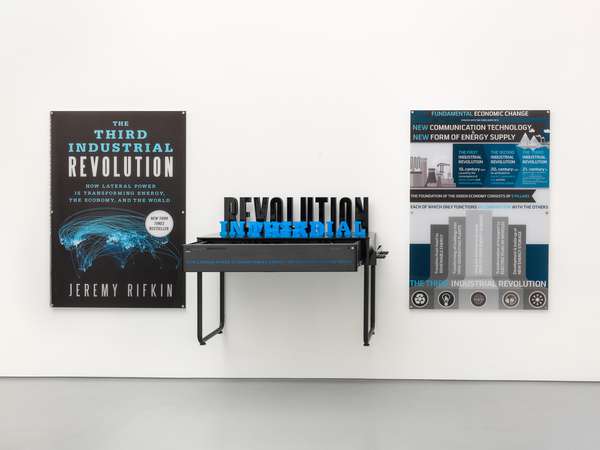











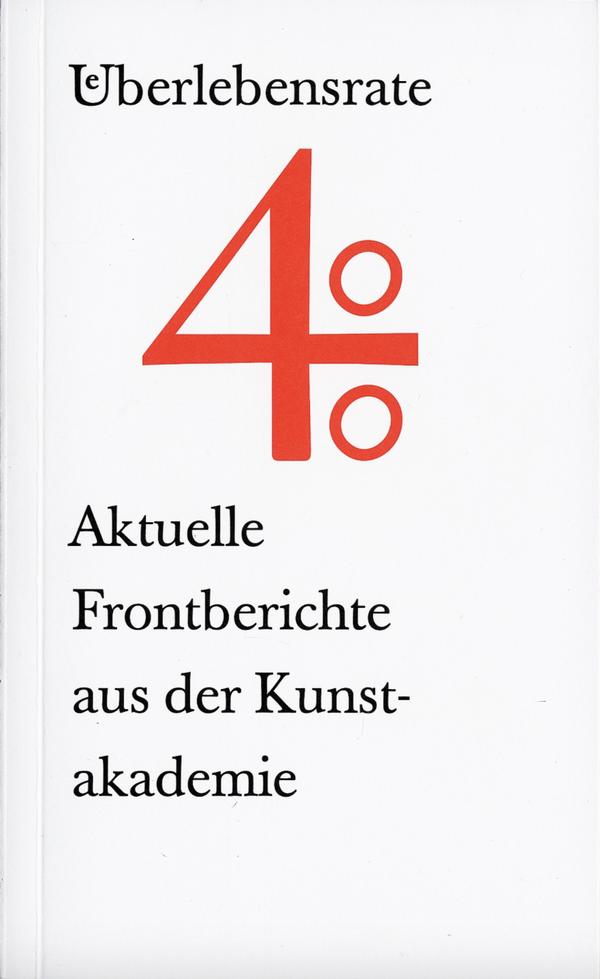


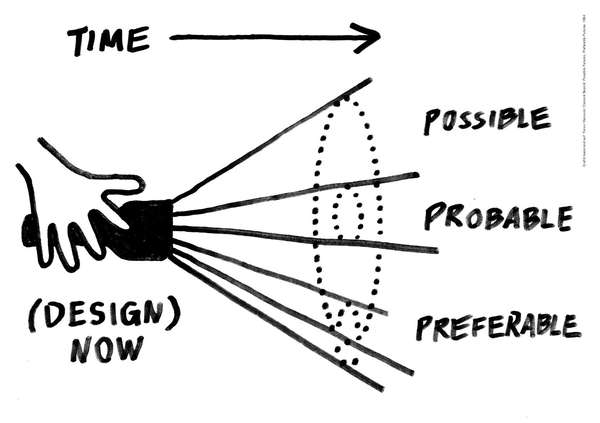
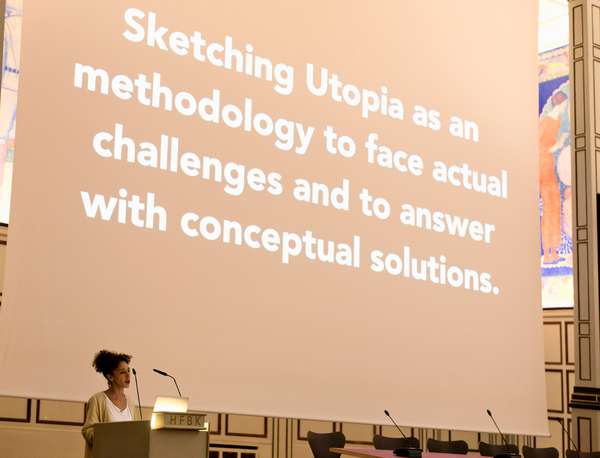
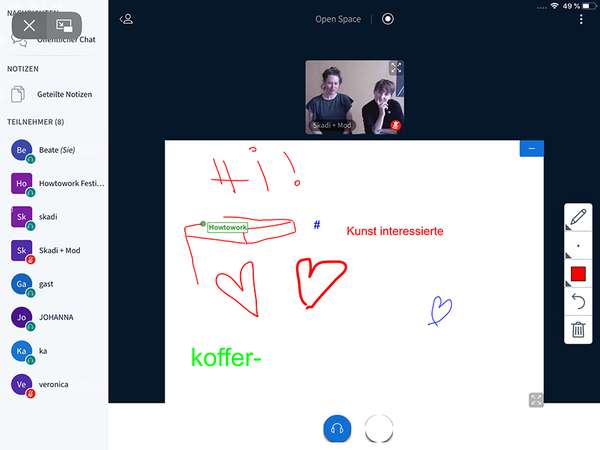

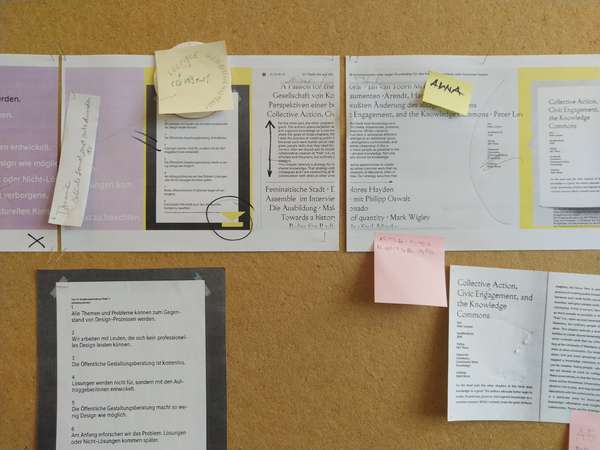
 Graduate Show 2025: Don't stop me now
Graduate Show 2025: Don't stop me now
 Lange Tage, viel Programm
Lange Tage, viel Programm
 Cine*Ami*es
Cine*Ami*es
 Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft
Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft
 Kunst im öffentlichen Raum
Kunst im öffentlichen Raum
 How to apply: Studium an der HFBK Hamburg
How to apply: Studium an der HFBK Hamburg
 Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg
 Der Elefant im Raum – Skulptur heute
Der Elefant im Raum – Skulptur heute
 Hiscox Kunstpreis 2024
Hiscox Kunstpreis 2024
 Die Neue Frau
Die Neue Frau
 Promovieren an der HFBK Hamburg
Promovieren an der HFBK Hamburg
 Graduate Show 2024 - Letting Go
Graduate Show 2024 - Letting Go
 Finkenwerder Kunstpreis 2024
Finkenwerder Kunstpreis 2024
 Archives of the Body - The Body in Archiving
Archives of the Body - The Body in Archiving
 Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa
Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa
 Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg
 (Ex)Changes of / in Art
(Ex)Changes of / in Art
 Extended Libraries
Extended Libraries
 And Still I Rise
And Still I Rise
 Let's talk about language
Let's talk about language
 Graduate Show 2023: Unfinished Business
Graduate Show 2023: Unfinished Business
 Let`s work together
Let`s work together
 Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg
 Symposium: Kontroverse documenta fifteen
Symposium: Kontroverse documenta fifteen
 Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image
Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image
 Einzelausstellung von Konstantin Grcic
Einzelausstellung von Konstantin Grcic
 Kunst und Krieg
Kunst und Krieg
 Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun
Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun
 Der Juni lockt mit Kunst und Theorie
Der Juni lockt mit Kunst und Theorie
 Finkenwerder Kunstpreis 2022
Finkenwerder Kunstpreis 2022
 Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule
Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule
 Raum für die Kunst
Raum für die Kunst
 Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg
 Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments
Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments
 Diversity
Diversity
 Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021
Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021
 Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen
Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen
 Schule der Folgenlosigkeit
Schule der Folgenlosigkeit
 Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg
 Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020
Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020
 Digitale Lehre an der HFBK
Digitale Lehre an der HFBK
 Absolvent*innenstudie der HFBK
Absolvent*innenstudie der HFBK
 Wie politisch ist Social Design?
Wie politisch ist Social Design?