Dr. phil. in art. Frank Wörler
Das Symbolische, das Imaginäre und das Reale. Lacans drei Ordnungen als erkenntnistheoretisches Modell
Betreuung: Prof. Dr. Hans-Joachim Lenger, Prof. Dr. Michaela Ott
Disputation am 16.10.2014
War die Lacan-Rezeption hierzulande zunächst von einer literaturwissenschaftlichen Perspektive bestimmt, gibt es in jüngerer Zeit vermehrt Ansätze, die Theoriefiguren des französischen Psychoanalytikers in Bezug auf eine allgemeinere Diskursgeschichte zu interpretieren und ihre Referenzen zu befragen.
In dieses Forschungsbemühen reiht sich mein Promotionsprojekt ein, das einen kleinen Ausschnitt aus der Lacan'schen Lehre – seine Trias aus einem Symbolischen, einem Imaginären und einem Realen –, dezidiert zum Zeitpunkt der ersten Ausformulierung, zum Anlass nimmt, wichtige Bezugnahmen des Analytikers zu recherchieren und zu rekonstruieren.
Diese Bezüge verweisen auf ein allgemeines erkenntnistheoretisches Interesse Lacans, der sich, um seine Seminare auf der intellektuellen Höhe seiner Zeit zu halten, einer Vielzahl fachfremder Konzepte bedient. Zusammen genommen helfen diese beliehenen Begrifflichkeiten, die psychoanalytische Theorie dreier »Register« besser zu verstehen. Darüber hinaus zeichnet sich aber auch ein Bild ab, welches diese Trias innerhalb eines die Disziplinen überspannenden Disputs über mögliche Formen wissenschaftlicher Erkenntnis situiert.
Vortragende sind in dieser Diskussion Ernst Cassirer, der im Rückgriff auf Hermann von Helmholtz einen naturwissenschaftlichen Anker wirft, um das Symbolische zu situieren, des weiteren Jakob von Uexküll, der als Biologe die fundamentale Frage des Beobachters aufwirft. In Bezug auf die irisierende Funktion des Imaginären findet sich beim frühen Franz Brentano der psychologisch gesetzte Begriff der Intentionalität, welcher für die Phänomenologen Jean-Paul Sartre und Maurice Merleau-Ponty den Ausgangspunkt ihrer Begriffe eines Imaginären und eines Realen bildet. Ob etwas imaginär oder real sei – diese Frage hat eine lange Tradition in der abendländischen Philosophiegeschichte, doch sie bricht sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts in neuen Spektren. Der Epistemologe Émile Meyerson erörtert – mithin seinem bekannter gewordenen Schüler Thomas Kuhn den Weg bereitend – verschiedene Erkenntnistypen. Das Reale ist für ihn eine spezifische Art und Weise des Weltzugangs. Meyerson greift die Bergson'sche Wissenschaftskritik auf und verbindet sie mit einer geschichtlichen Analyse, die sich entschieden gegen das Comte'sche Diktum (wissenschaftlicher Sinn-Abstinenz) stellt, womit sich ein argumentativer Kreis im 19. Jahrhundert schließt: an jenem Ausgangspunkt symbolisch dominierter Wissenschaftspraxis, die im naturwissenschaftlichen Feld von Helmholtz formuliert wurde.
Die immer wiederkehrende Auseinandersetzung mit Henri Bergson ist bezeichnend für die epistemologische Debatte im Frankreich des 20. Jahrhunderts, in welcher auch Lacan seinen Platz einnimmt. Die Überprüfung der zusammengetragenen Bestimmungen eines Symolischen, eines Imaginären und eines Realen erfolgt in meiner Dissertation jedoch in Diskussion mit einem amerikanischen Logiker: Charles Peirce.
Als vorläufiges Ergebnis meiner Recherche biete ich eine epistemologische Trias an, die sich nicht allein auf die psychoanalytische Praxis bezieht, sondern sogar losgelöst von dieser spezifischen Theorie Rückhalt in zahlreichen Denkfiguren erkenntnistheoretisch motivierter Philosophen und Wissenschaftler findet. Die Frage ist, ob mit einem Symbolischen, einem Imaginären und einem Realen nicht allgemeine funktionale Prinzipien des Erkennens beschrieben sind. Können diese als epistemologisches Werkzeug helfen, aktuelle erkenntnistheoretische Fragestellungen zu sondieren?
Die Dissertation ist im September 2015 im transcript verlag, Bielefeld, erschienen: http://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3261-3/das-symbolische-das-imaginaere-und-das-reale
Kontakt: f.woerler@web.de









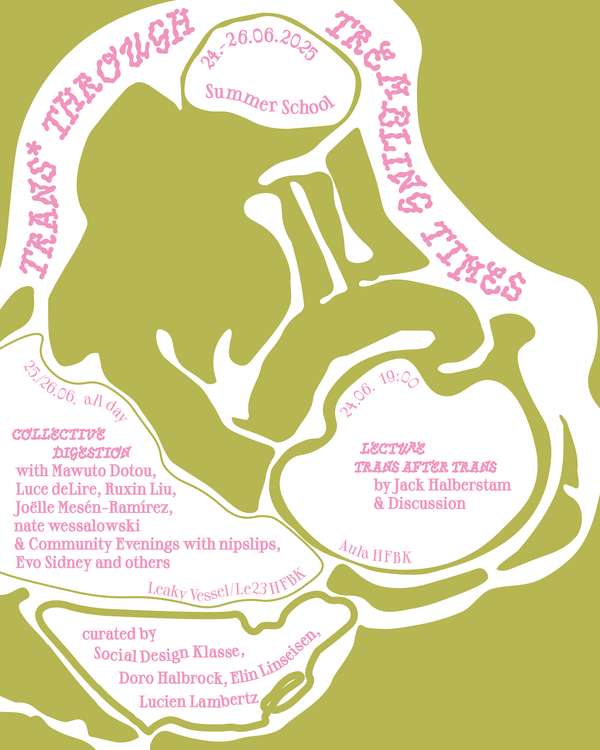





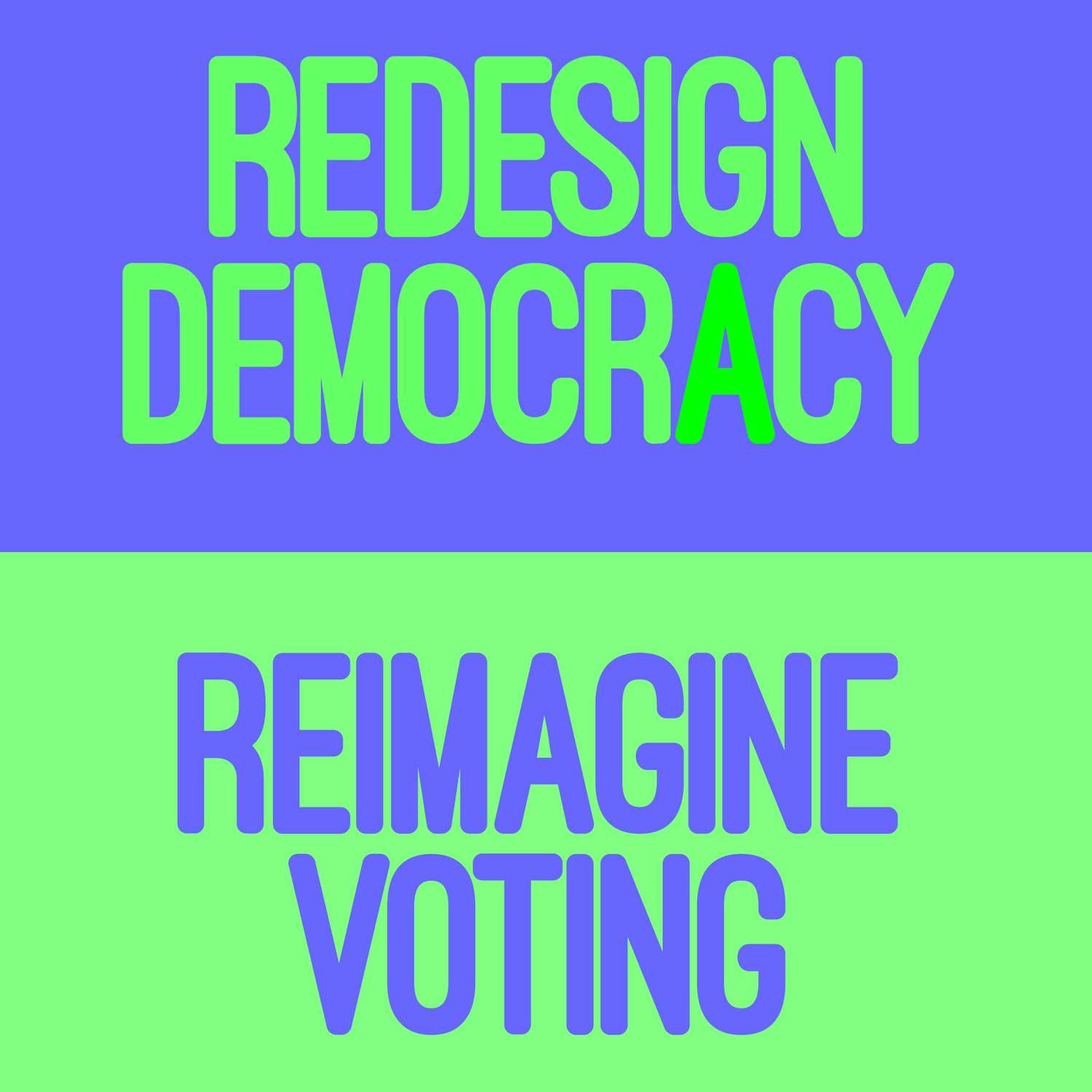











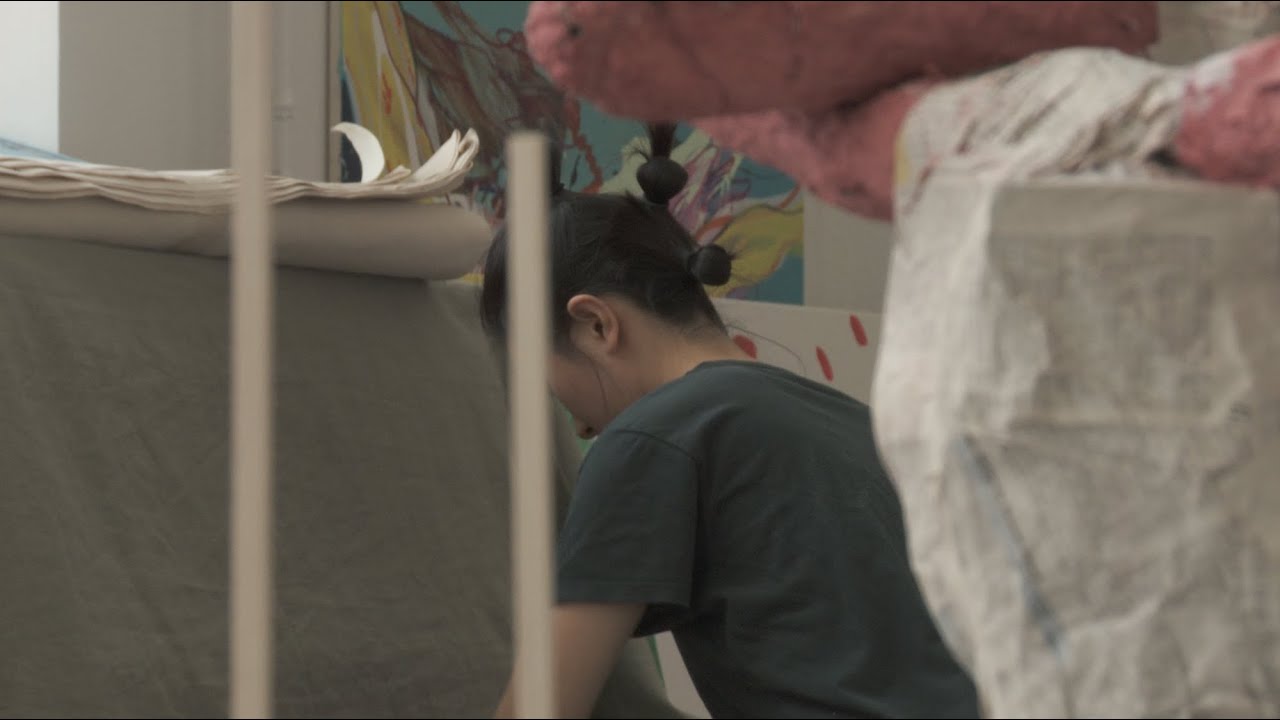






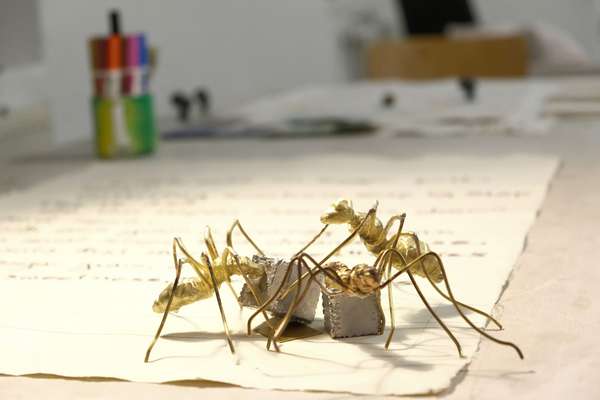



















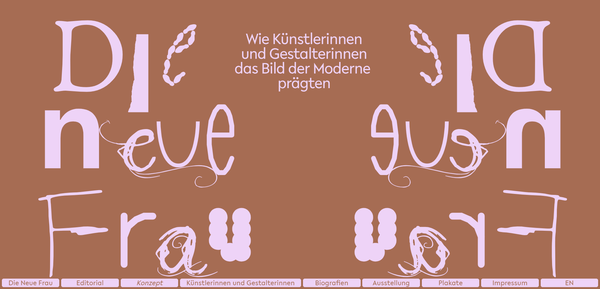
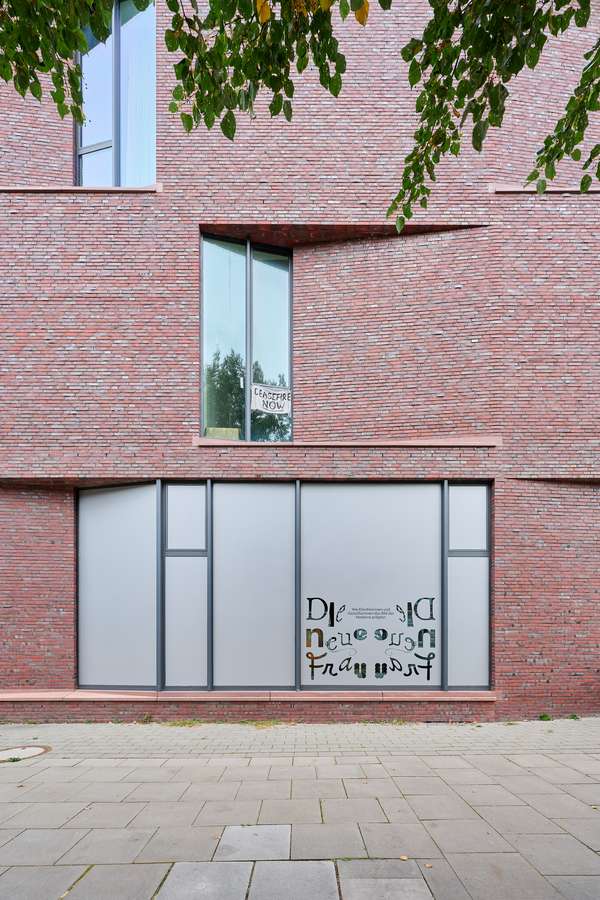



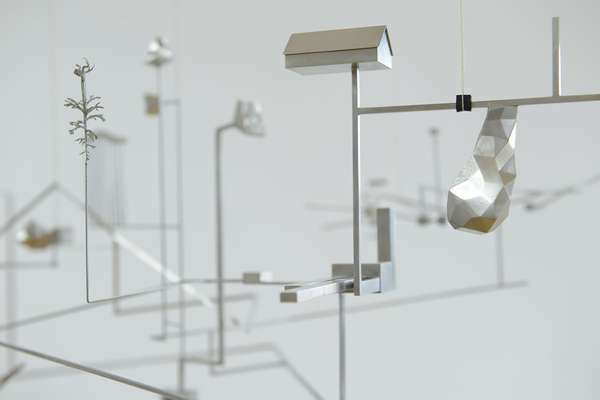











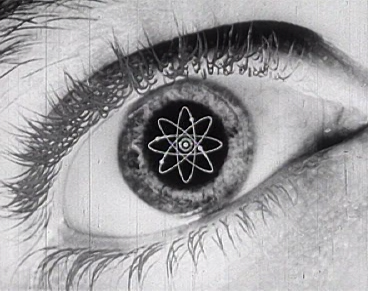
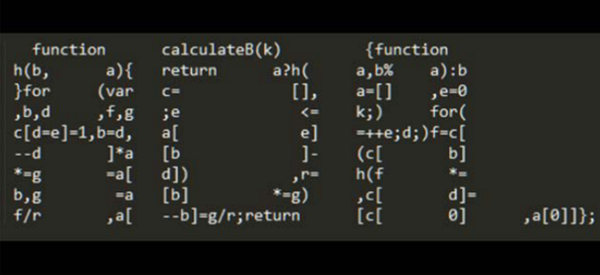
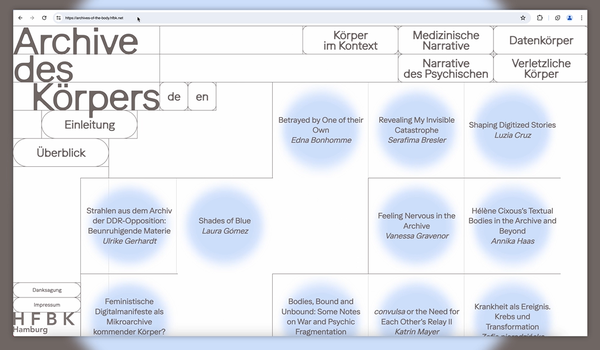
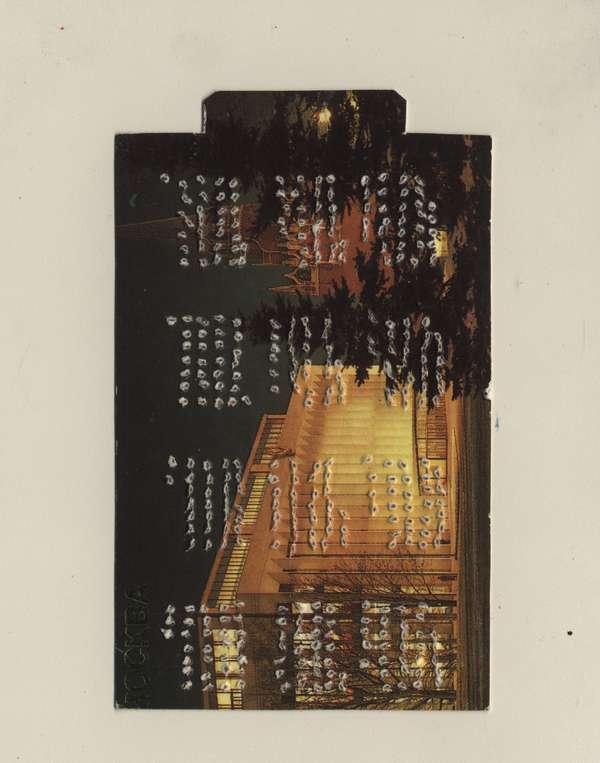
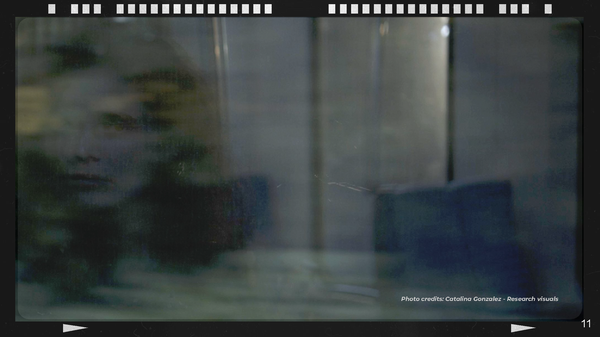



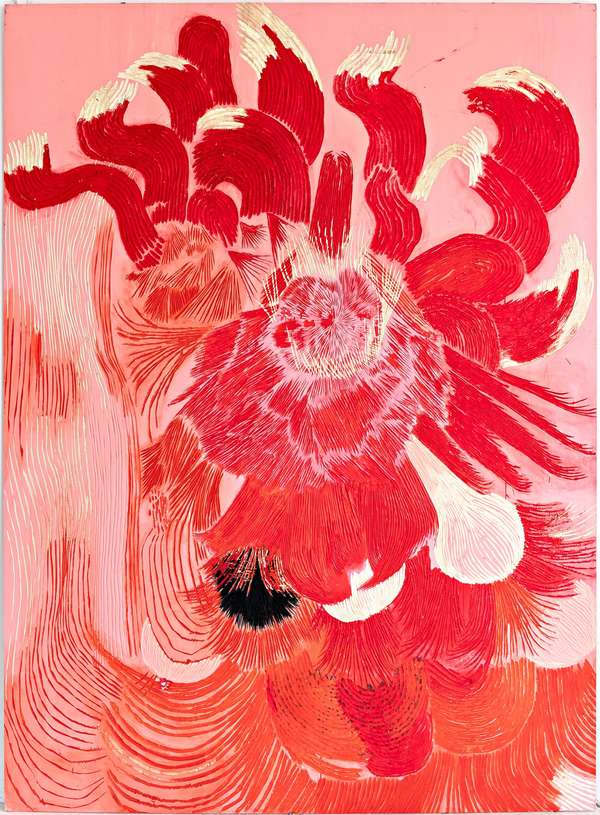







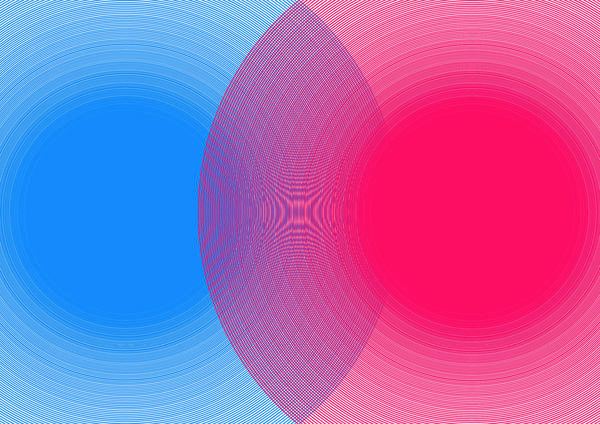






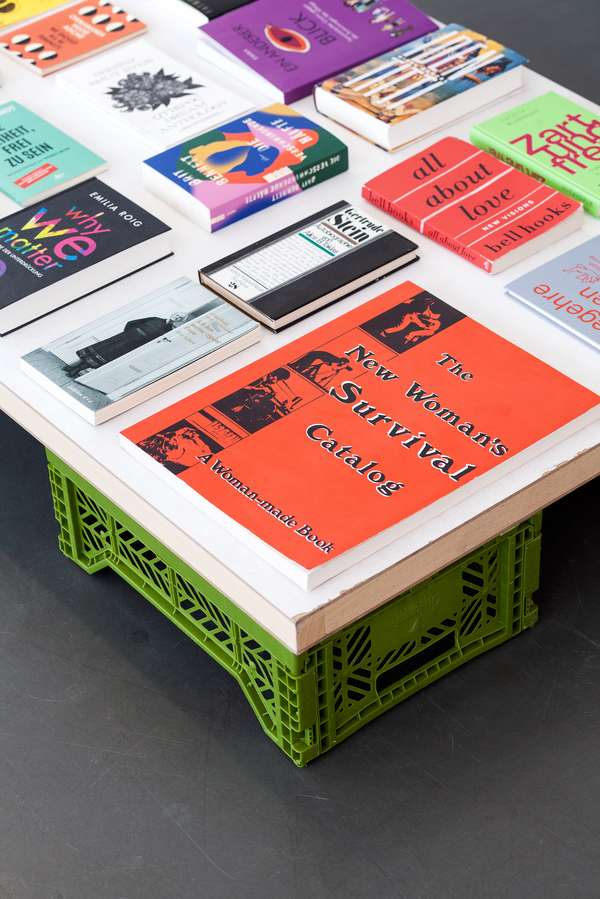



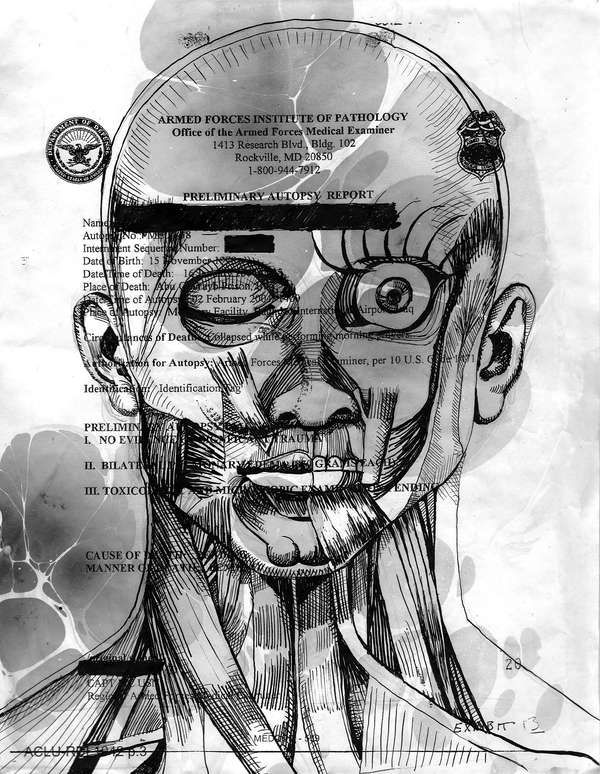

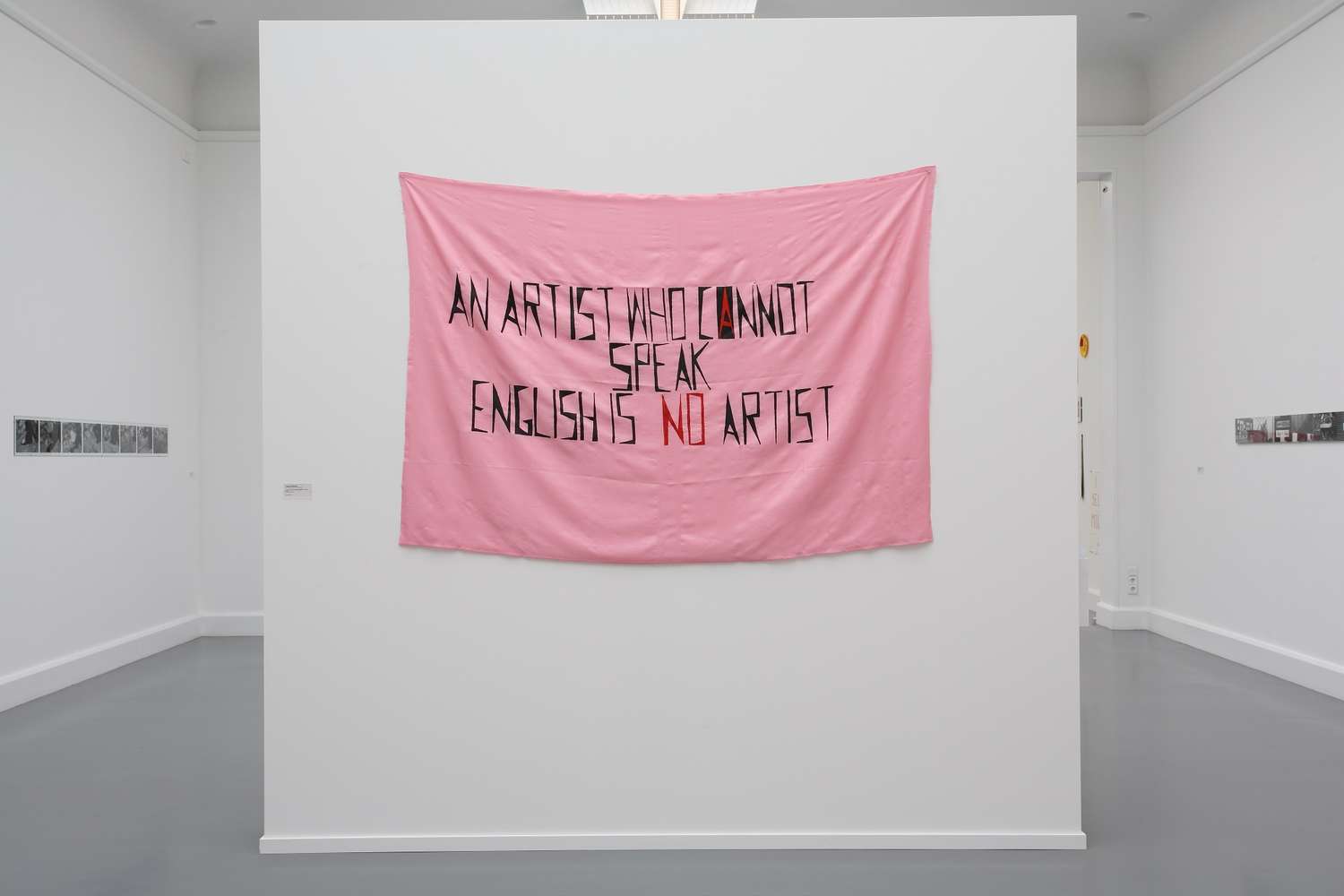

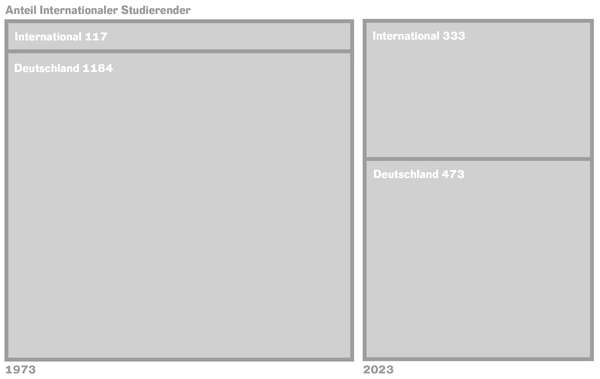
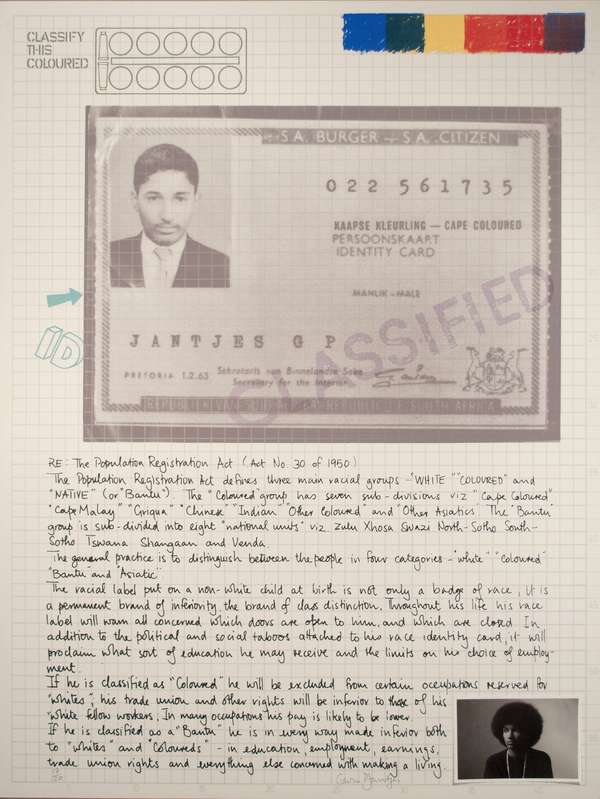
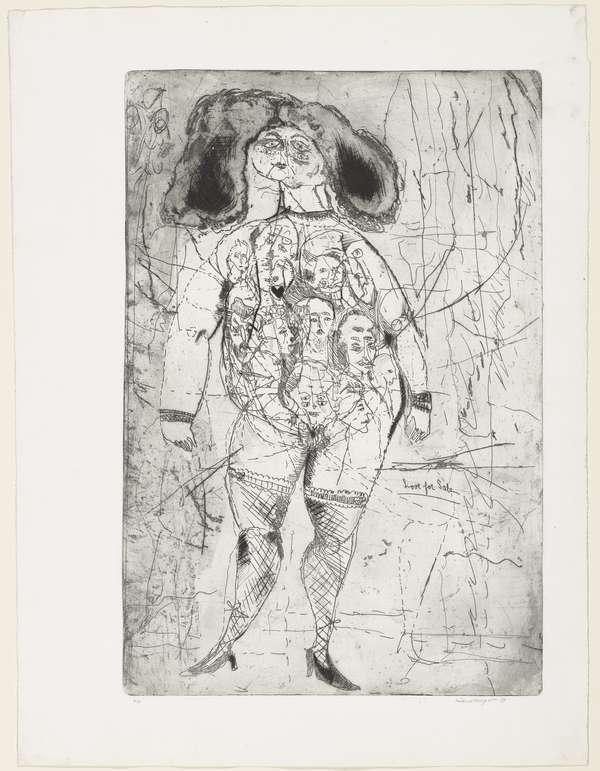
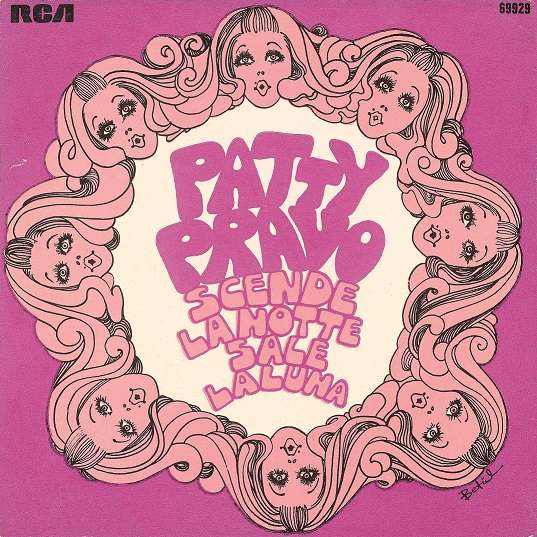





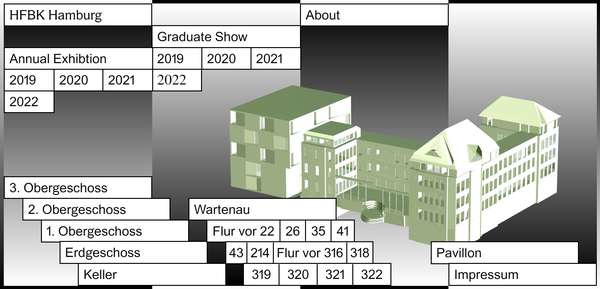
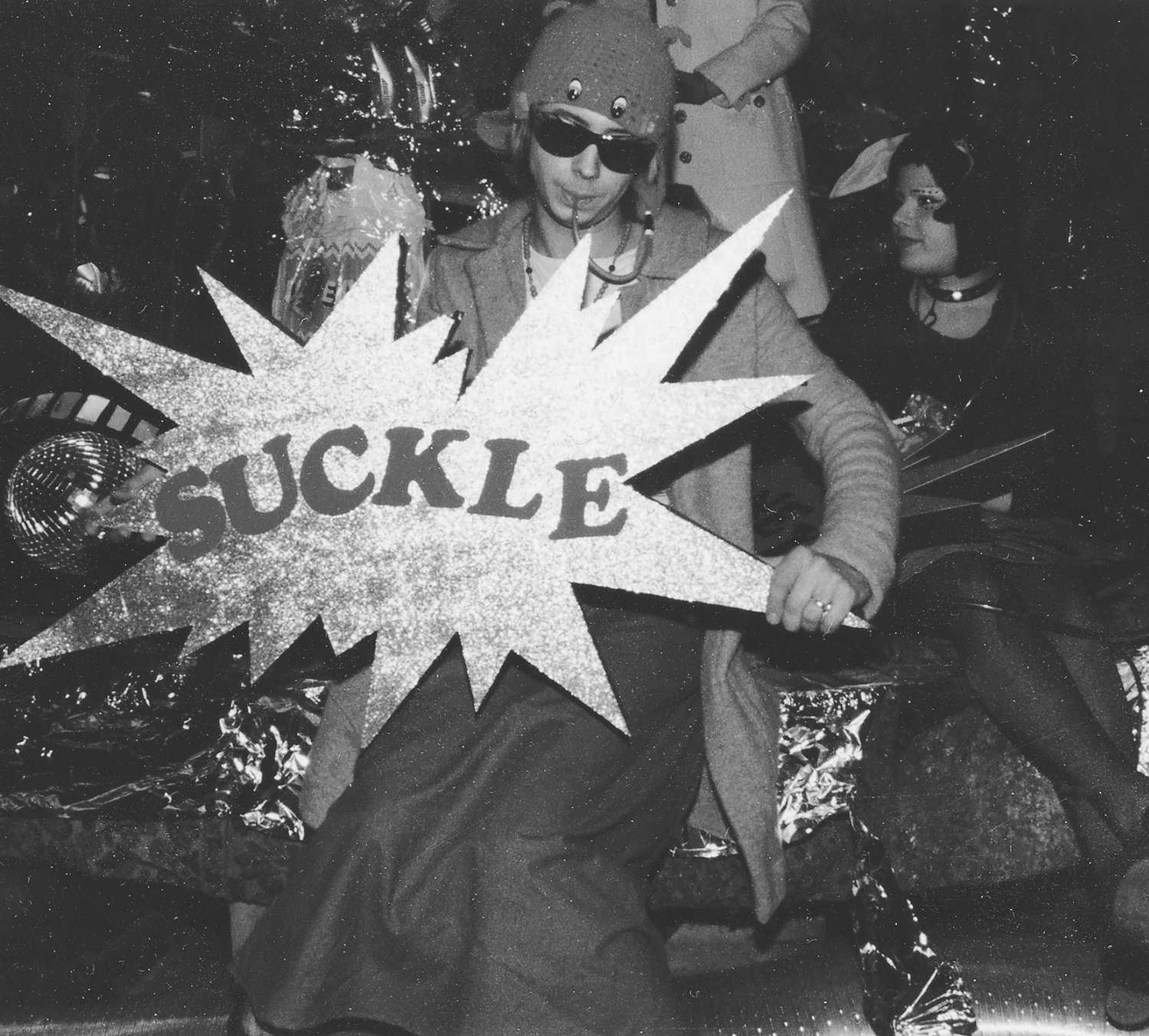



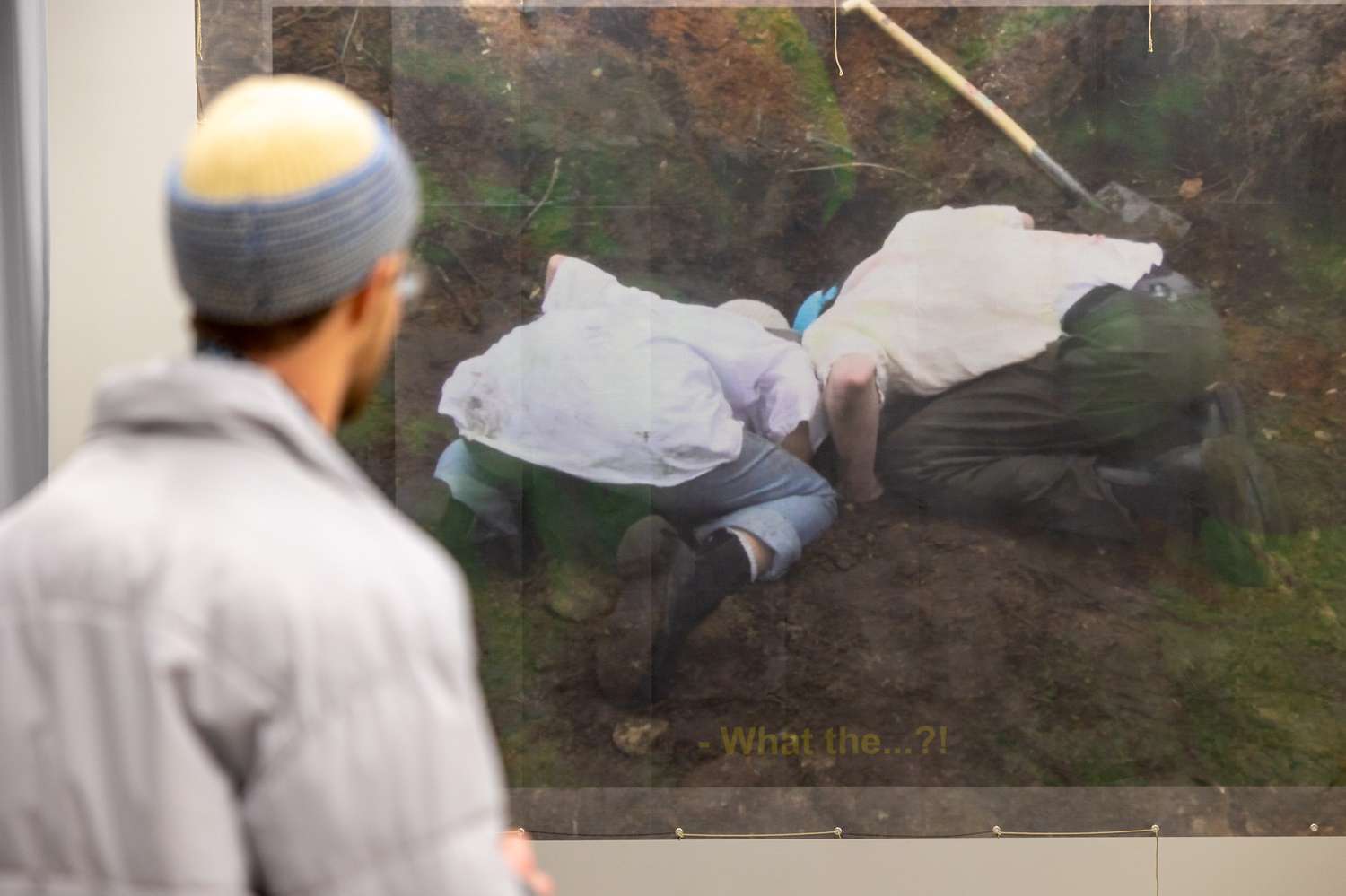


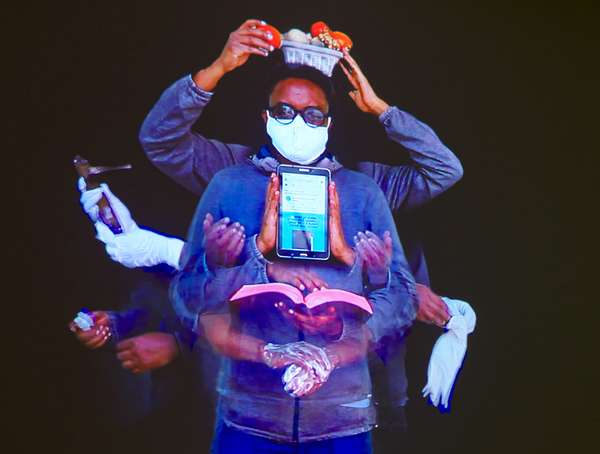
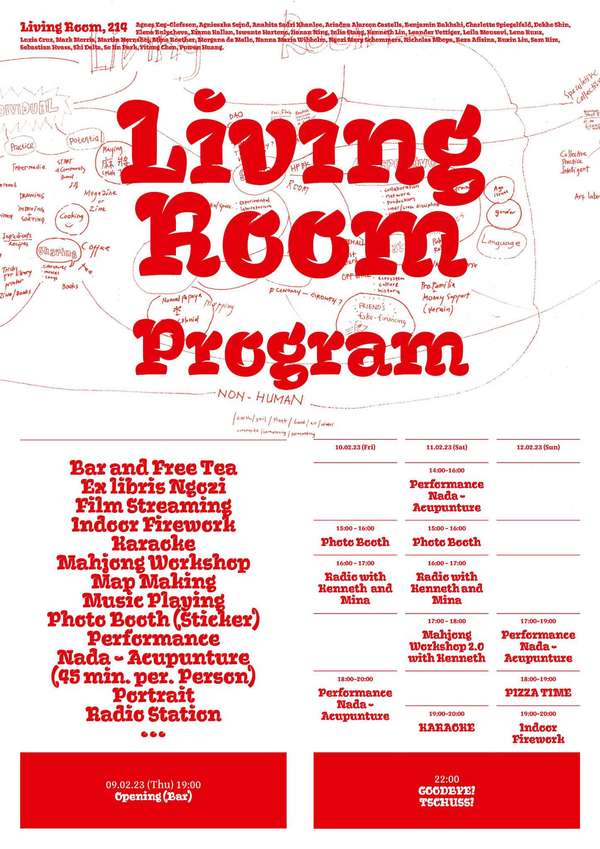
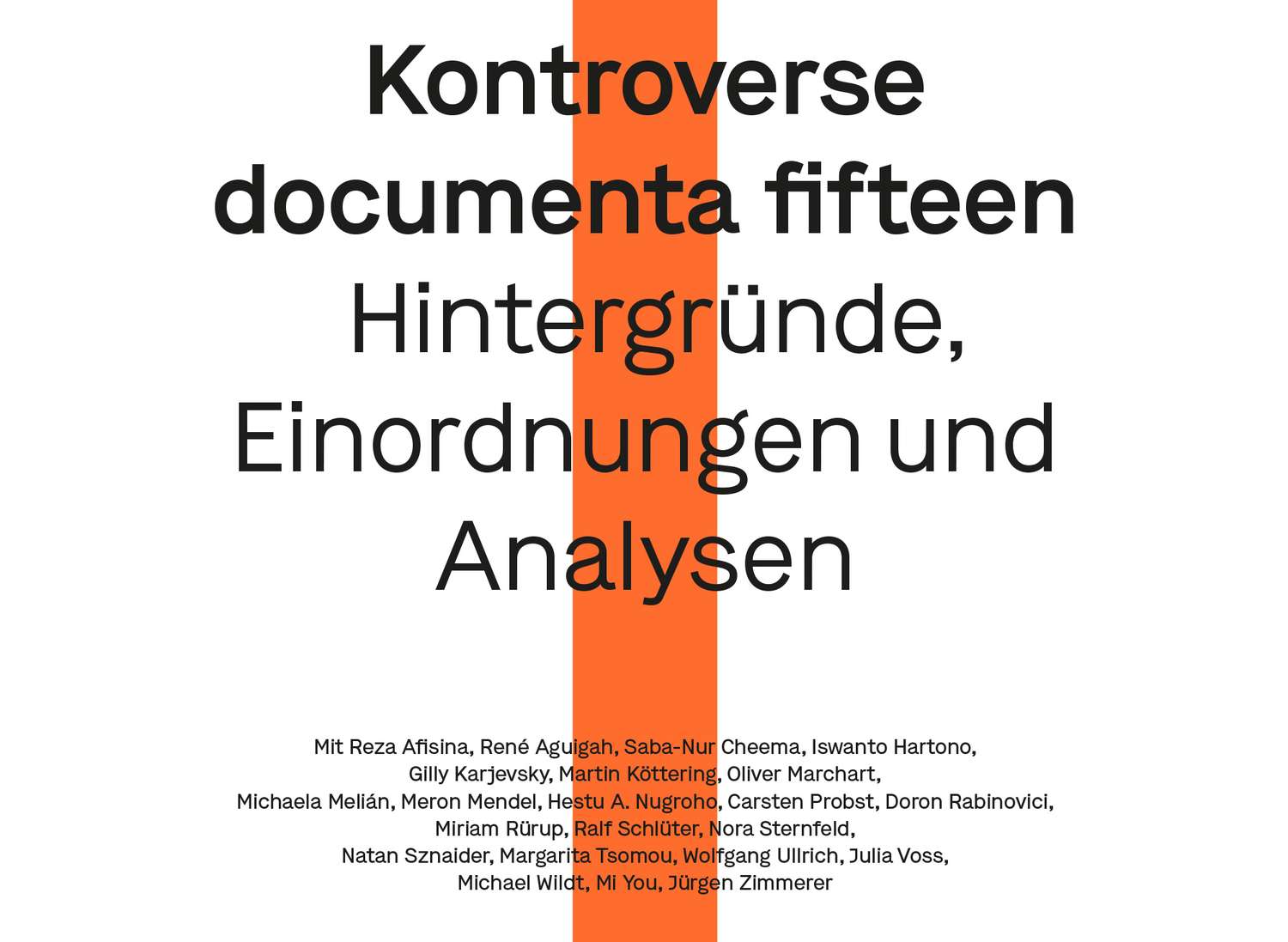




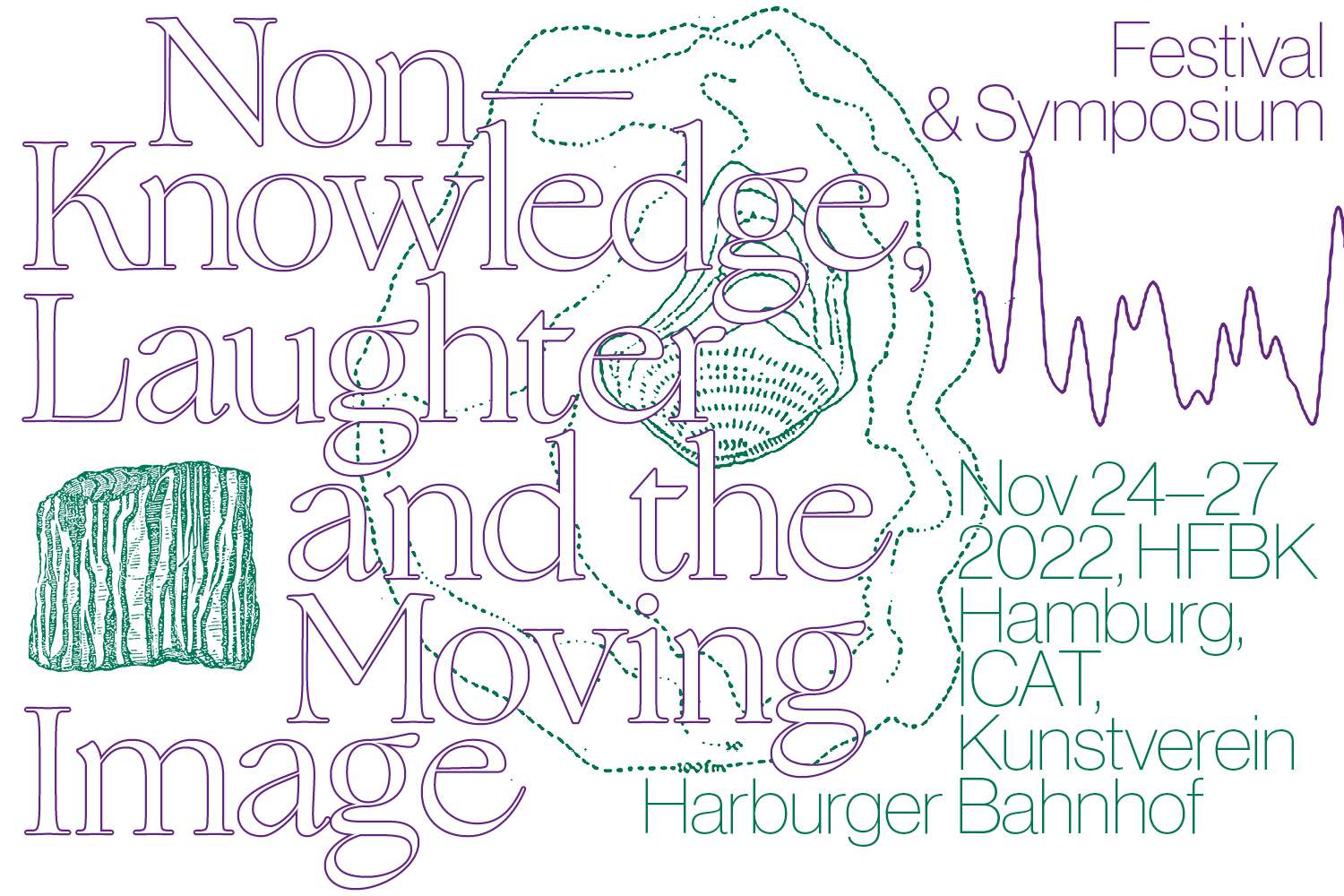









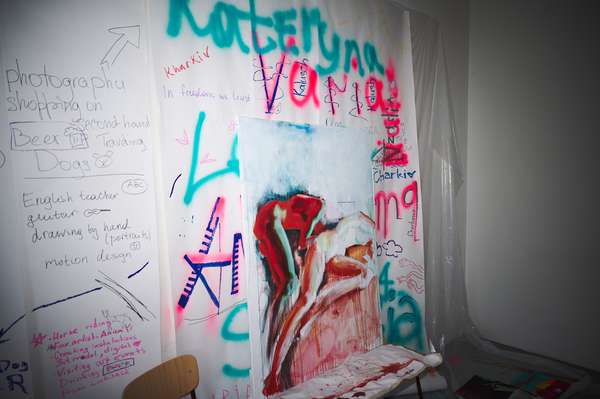




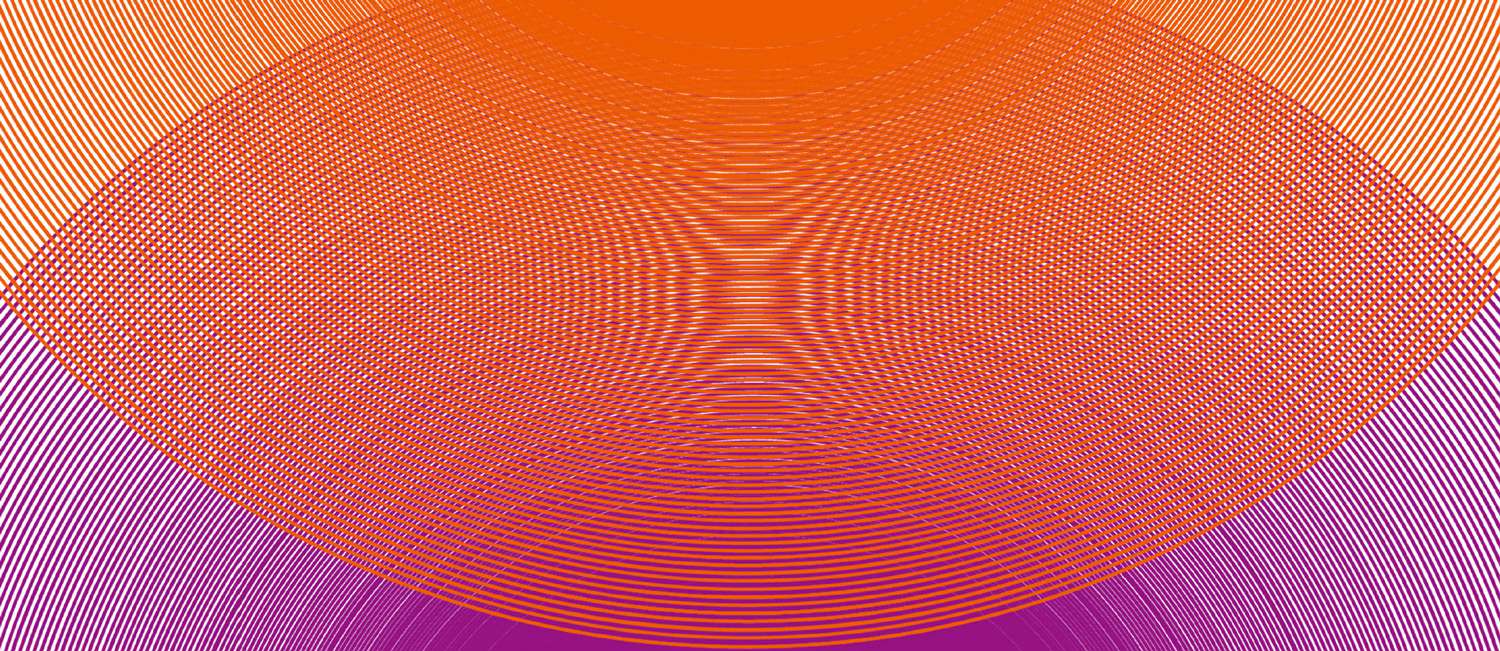
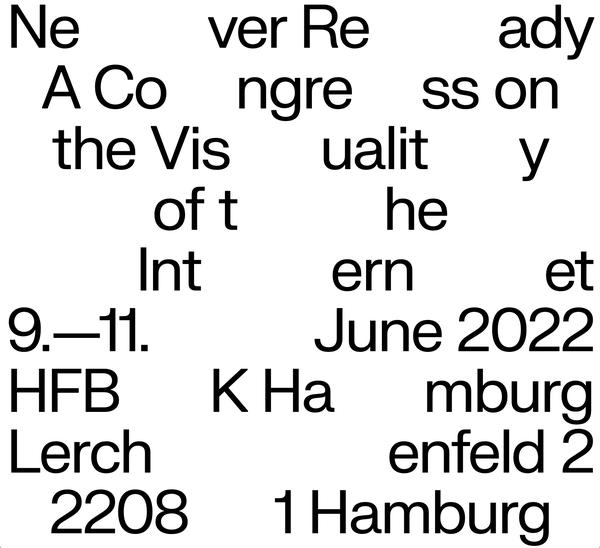
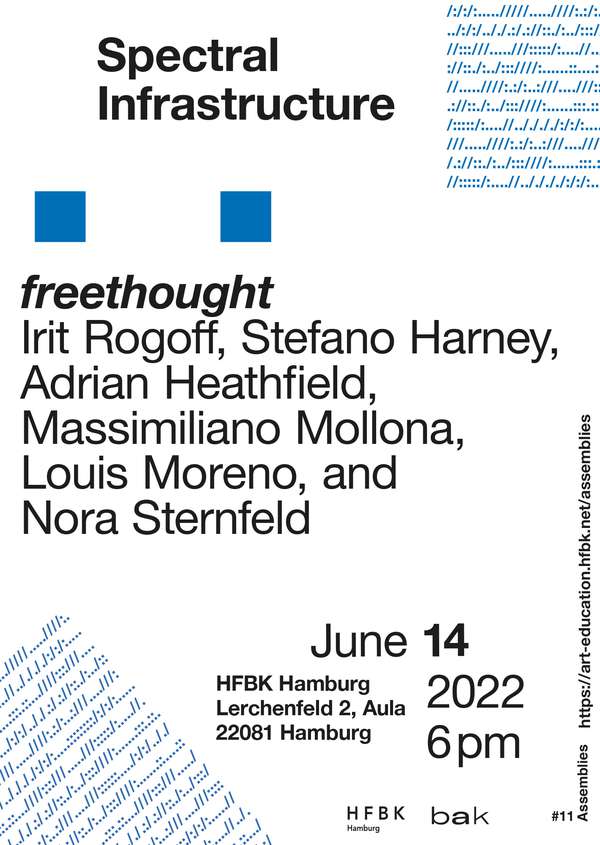

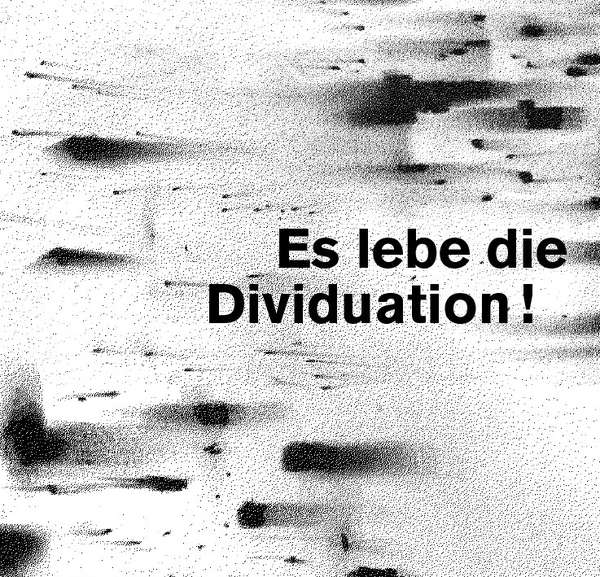
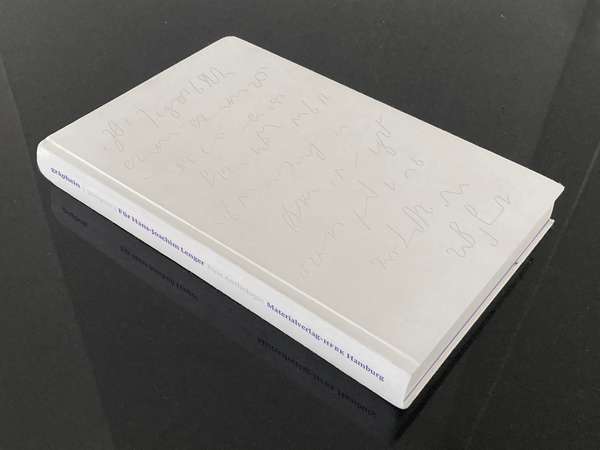
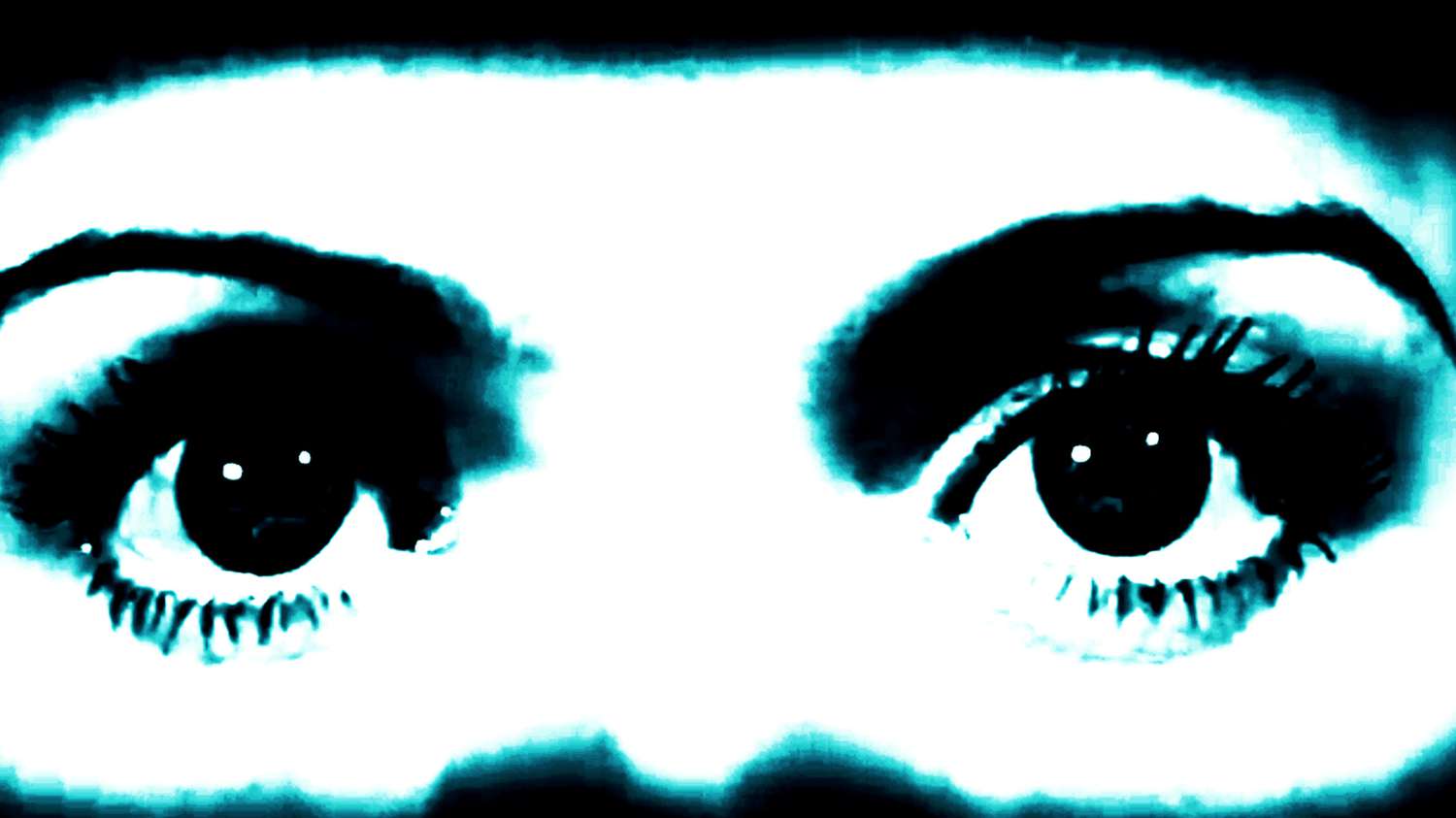
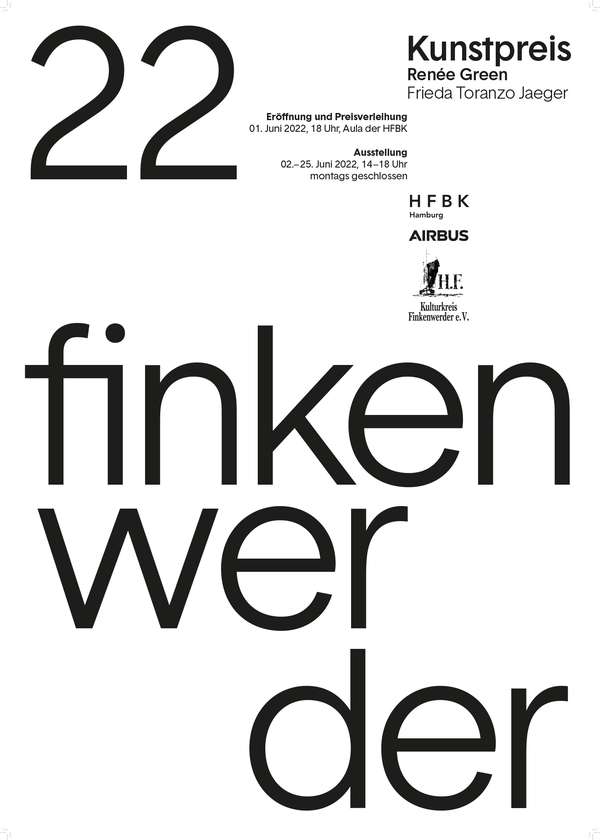















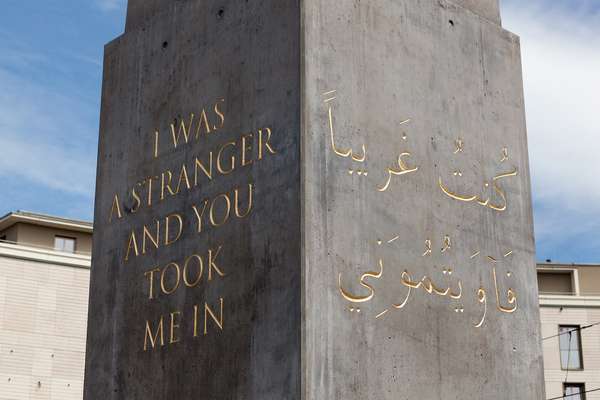
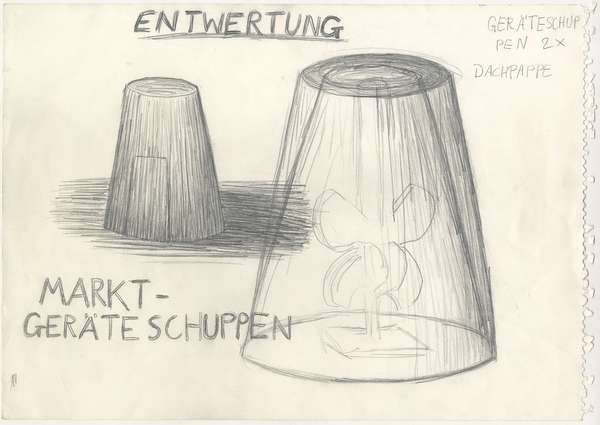
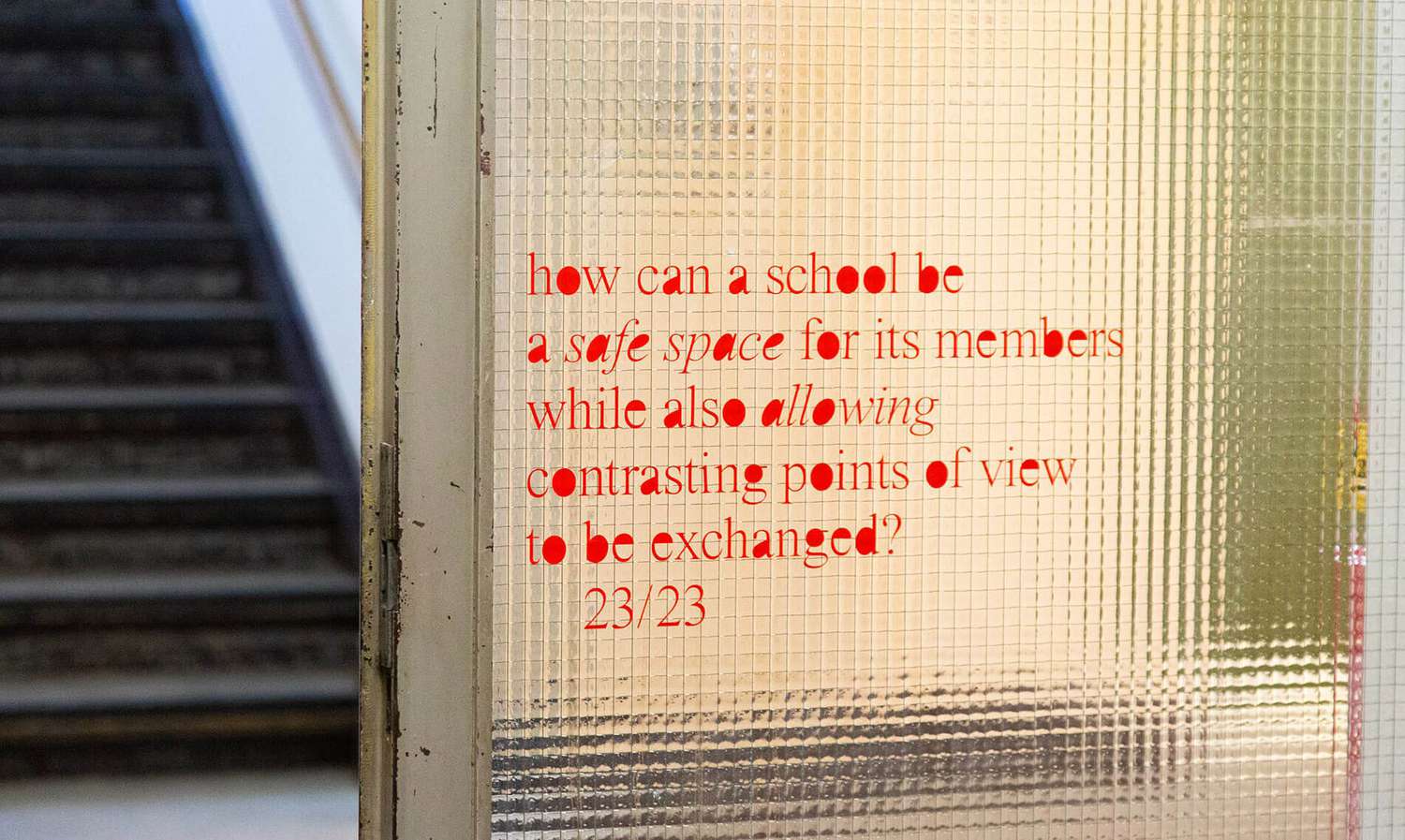

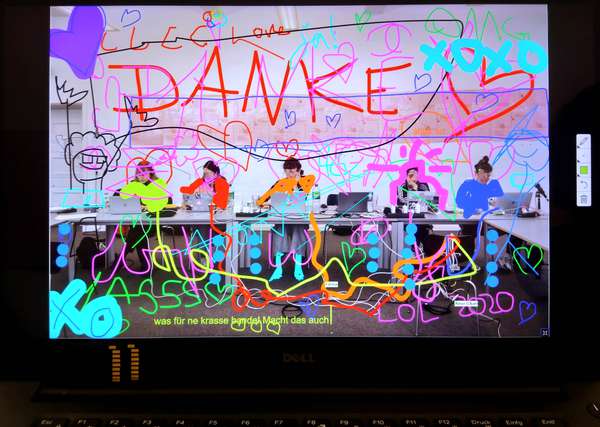
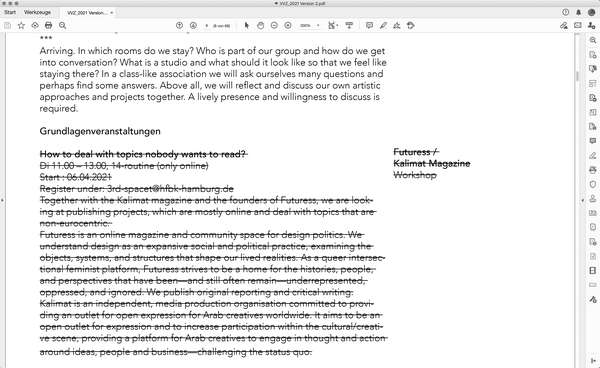
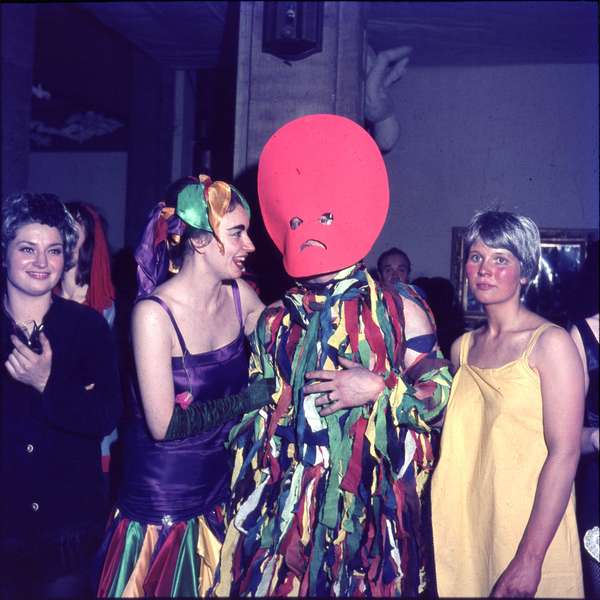





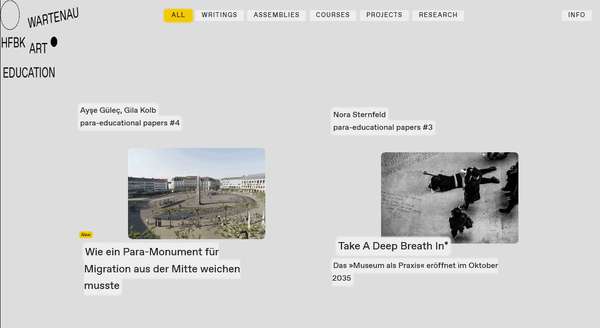

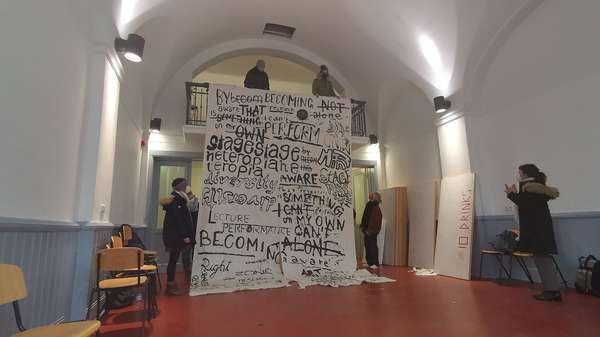
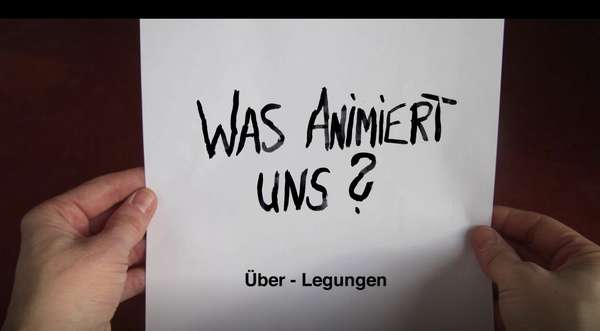





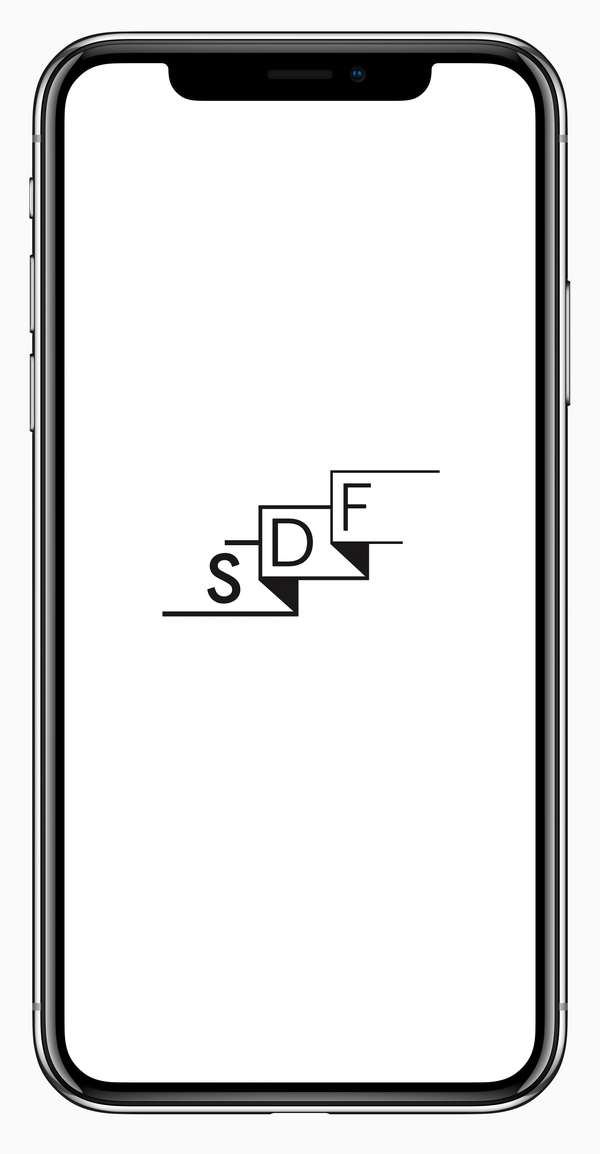
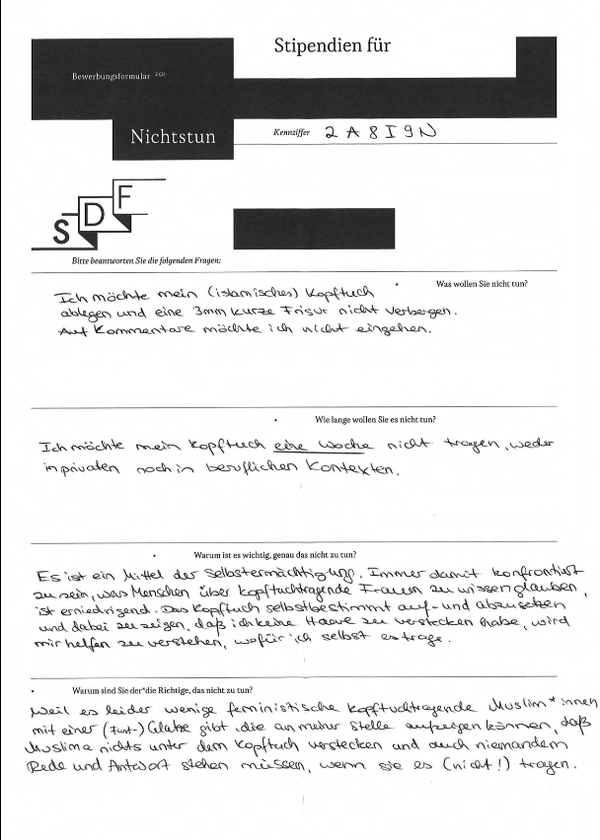


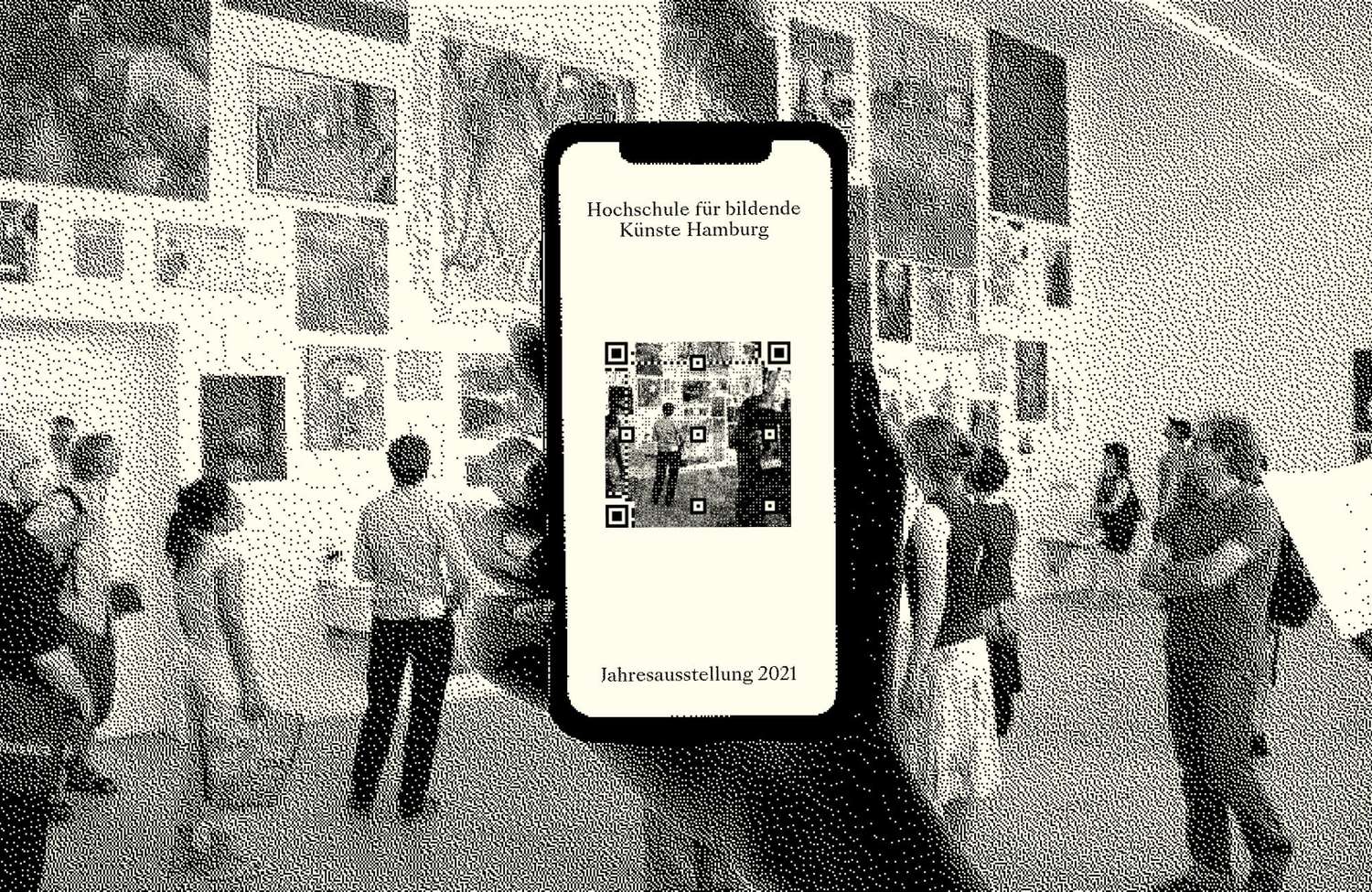

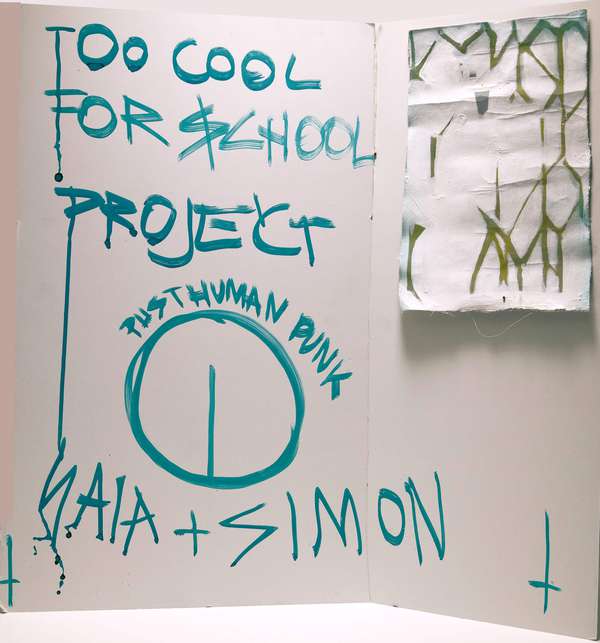

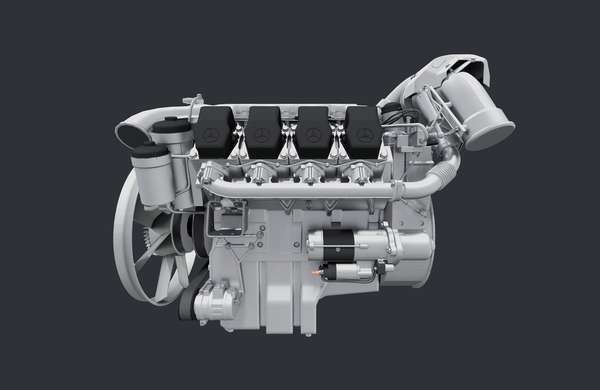





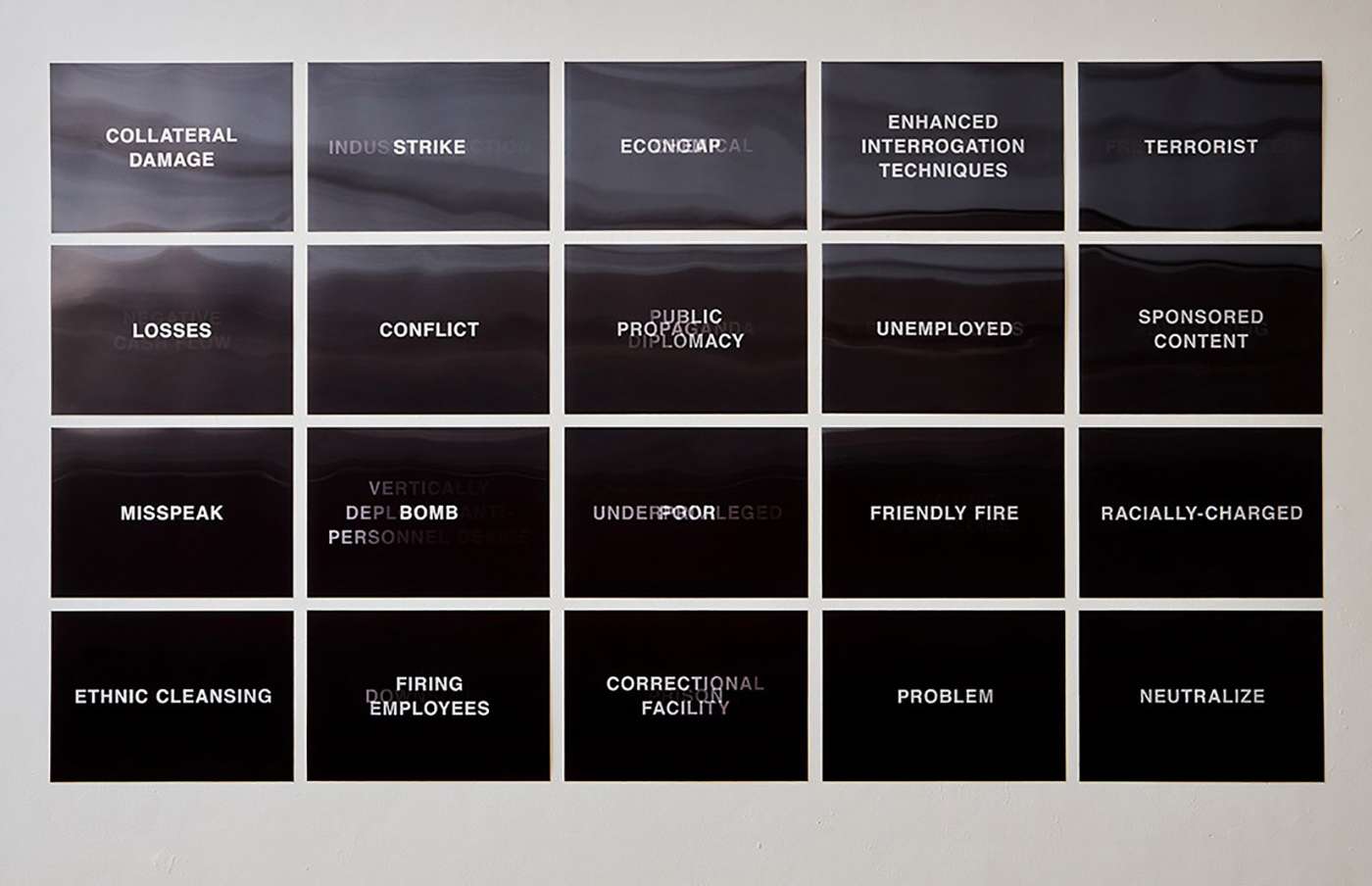




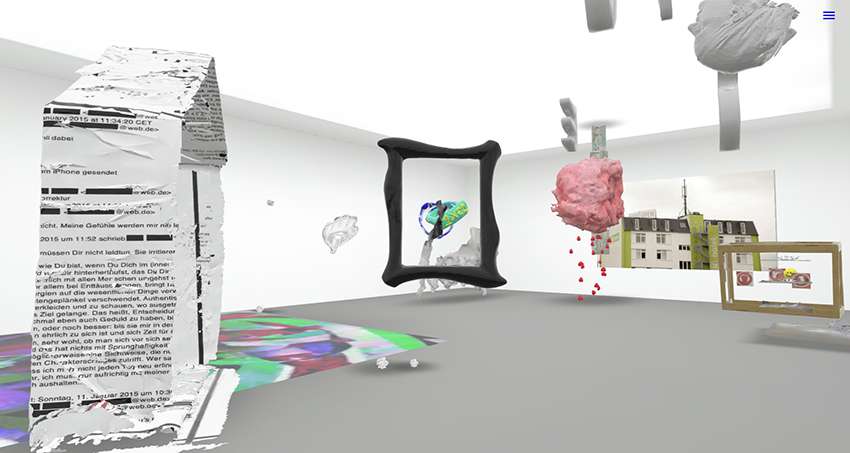
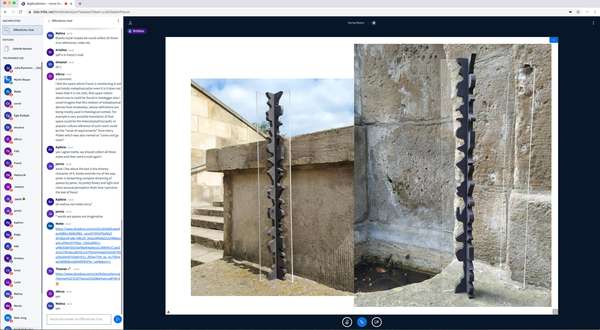
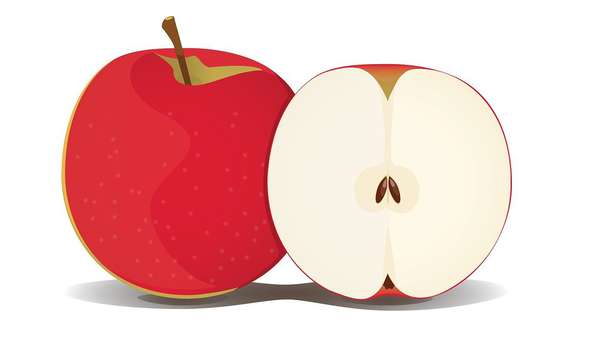

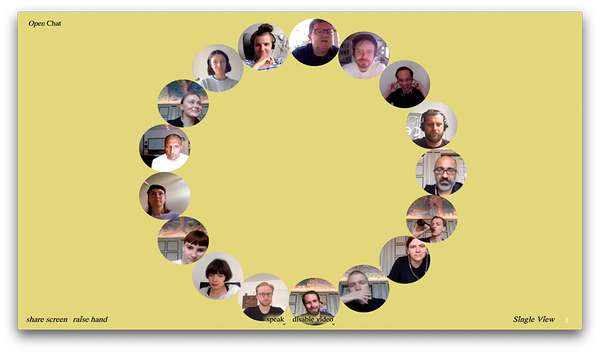
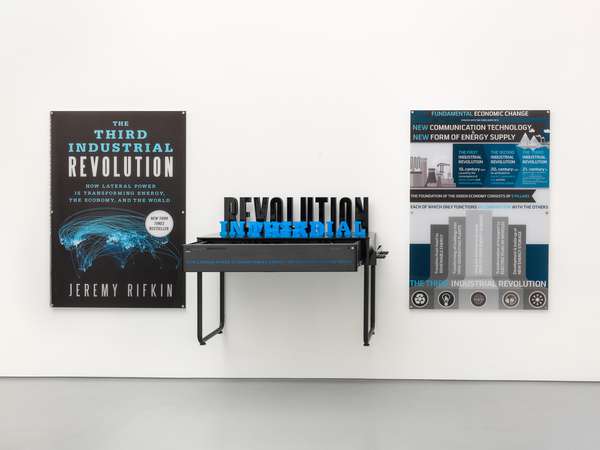











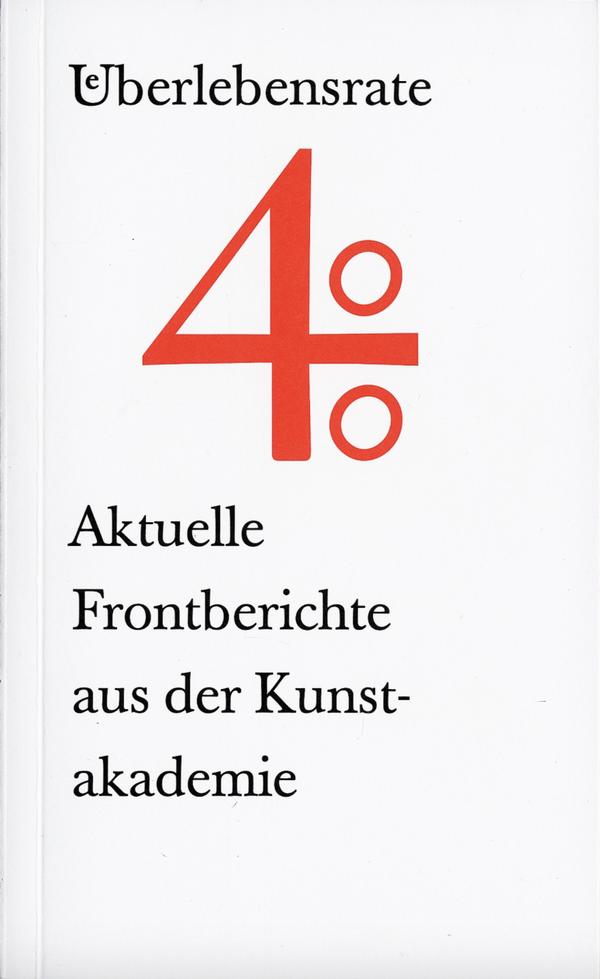


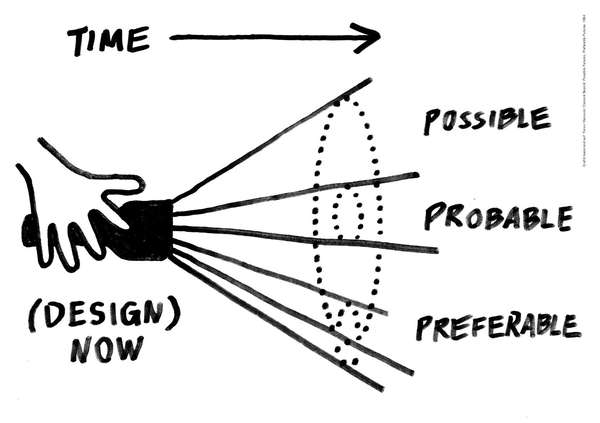
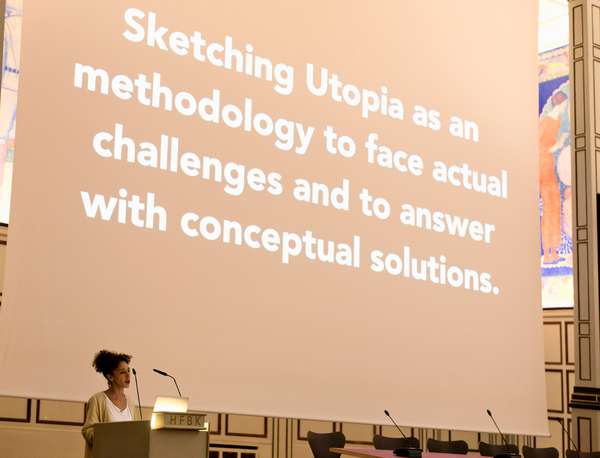
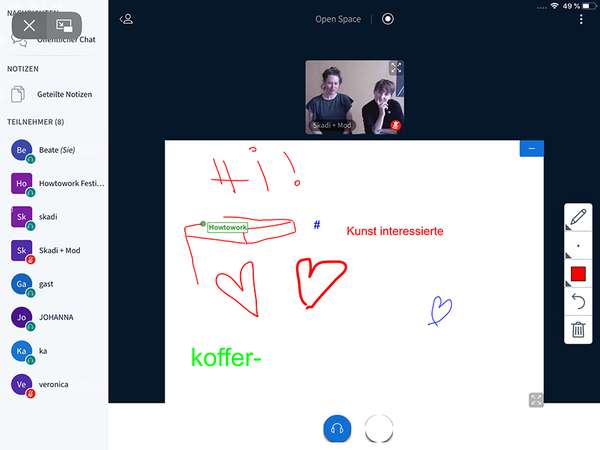

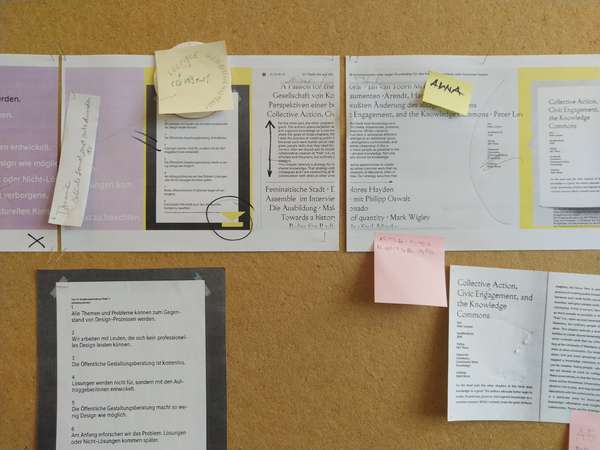
 Graduate Show 2025: Don't stop me now
Graduate Show 2025: Don't stop me now
 Lange Tage, viel Programm
Lange Tage, viel Programm
 Cine*Ami*es
Cine*Ami*es
 Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft
Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft
 Kunst im öffentlichen Raum
Kunst im öffentlichen Raum
 How to apply: Studium an der HFBK Hamburg
How to apply: Studium an der HFBK Hamburg
 Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg
 Der Elefant im Raum – Skulptur heute
Der Elefant im Raum – Skulptur heute
 Hiscox Kunstpreis 2024
Hiscox Kunstpreis 2024
 Die Neue Frau
Die Neue Frau
 Promovieren an der HFBK Hamburg
Promovieren an der HFBK Hamburg
 Graduate Show 2024 - Letting Go
Graduate Show 2024 - Letting Go
 Finkenwerder Kunstpreis 2024
Finkenwerder Kunstpreis 2024
 Archives of the Body - The Body in Archiving
Archives of the Body - The Body in Archiving
 Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa
Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa
 Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg
 (Ex)Changes of / in Art
(Ex)Changes of / in Art
 Extended Libraries
Extended Libraries
 And Still I Rise
And Still I Rise
 Let's talk about language
Let's talk about language
 Graduate Show 2023: Unfinished Business
Graduate Show 2023: Unfinished Business
 Let`s work together
Let`s work together
 Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg
 Symposium: Kontroverse documenta fifteen
Symposium: Kontroverse documenta fifteen
 Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image
Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image
 Einzelausstellung von Konstantin Grcic
Einzelausstellung von Konstantin Grcic
 Kunst und Krieg
Kunst und Krieg
 Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun
Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun
 Der Juni lockt mit Kunst und Theorie
Der Juni lockt mit Kunst und Theorie
 Finkenwerder Kunstpreis 2022
Finkenwerder Kunstpreis 2022
 Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule
Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule
 Raum für die Kunst
Raum für die Kunst
 Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg
 Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments
Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments
 Diversity
Diversity
 Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021
Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021
 Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen
Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen
 Schule der Folgenlosigkeit
Schule der Folgenlosigkeit
 Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg
 Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020
Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020
 Digitale Lehre an der HFBK
Digitale Lehre an der HFBK
 Absolvent*innenstudie der HFBK
Absolvent*innenstudie der HFBK
 Wie politisch ist Social Design?
Wie politisch ist Social Design?