Tresen-Kolumne: Kohle und Bohne
Mein Vater wurde noch im Krieg geboren, meine Mutter kurz danach. Erst im Kontakt mit anderen Menschen fällt mir immer mal wieder auf, dass ich als Kind, das in den 1980er Jahren geboren wurde, aus der Familienlogik eigentlich Nachkriegsgeneration bin – Late Bloomer. Vielleicht bin ich deshalb so merkwürdig gebunden in meiner Beschäftigung mit der Unmöglichkeit Deutschlands. Inzwischen habe ich viel gesehen und gelesen und war hier und dort, um mein Unbehagen zu untermauern. Trotzdem setzt es sich immer auch sensorisch aus sehr spezifischen Bildern und Situationen zusammen, die durch meinen Geist blitzen, sobald ich an Deutschland denke: feuerverzinktes Stahlblech, hochkant verlegte Pflasterendsteine, der Geruch von Sonne auf Faserbetonplatten, Gelächter aus Garagen, kühle Hauseingänge, die nach Zeitung, Rauch und Lachspfanne riechen, Taft Haargel, das dumpfe Geräusch von zerbrechenden Grillanzündern, das schlesische Platt der älteren Nachbarin und über allen anderen thront der Geruch von Majoran, der sich verkuttert als Leberwurst morgens wie abends über die Brote der Stadt ergießt.
Auferstanden aus dem Wirtschaftswunder, dem Wunder von Bern und dem Sommermärchen erzählt dieses Land eine merkwürdig märchenhafte Geschichte des Voranschreitens und wie alle Märchen, ist auch dieses ein Katalysatoren für etwas anderes. Natürlich stimmt diese Geschichte nicht, aber sie klingt besser als die Gewalterzählung, die dahinter liegt, oder die Geschichte, als Deutschland mit einer Verwarnung laufen gelassen wurde, weil der Kommunismus den Westalliierten noch gefährlicher vorkam als die alten faschistischen Strukturen hierzulande.
Ich habe geträumt, ich wollte mir einen Hund besorgen und habe mich dann doch für eine große, grüne Heuschrecke entschieden, die eigentlich aussah wie eine aufgeklappte Brechbohne mit vier Beinen. Sie lief neben mir her und trug auf ihrem Rücken ein kleines Stück Parmesan für alle Fälle. Ich wachte enttäuscht von der Heuschrecke auf, ich weiß nicht warum. Das erinnert mich an das Märchen von der Kohle, der Bohne und dem Strohhalm, die alle dem Herdfeuer und dem Kochtopf einer älteren Frau entflohen sind, und sich zusammenschließen, um durch die Welt zu ziehen. Schon bald kommen sie an einen Bach und wissen nicht, wie sie hinübersetzen sollen. Da hat der Strohhalm eine Idee und legt sich quer von Ufer zu Ufer. Doch als die, immer noch glühende, Kohle auf den Strohhalm steigt, verbrennt dieser und beide stürzen in den Bach und ertrinken. Die Bohne am Ufer hatte nichts besseres zu tun, als über das Unglück ihrer Freund:innen so stark zu lachen, dass sie einfach platzte. Zum Glück saß am selben Bach ein Schneider auf Wanderschaft, der das ganze beobachtet hatte und nähte die Bohne mit schwarzem Faden wieder zusammen. Seitdem haben Bohnen eine Naht.
Ich frage mich seit jeher, was eigentlich die Moral dieser Geschichte sein soll. Vielleicht dass Schadenfreude nur dann ein Problem ist, wenn man dadurch selbst schwer verwundet wird.
















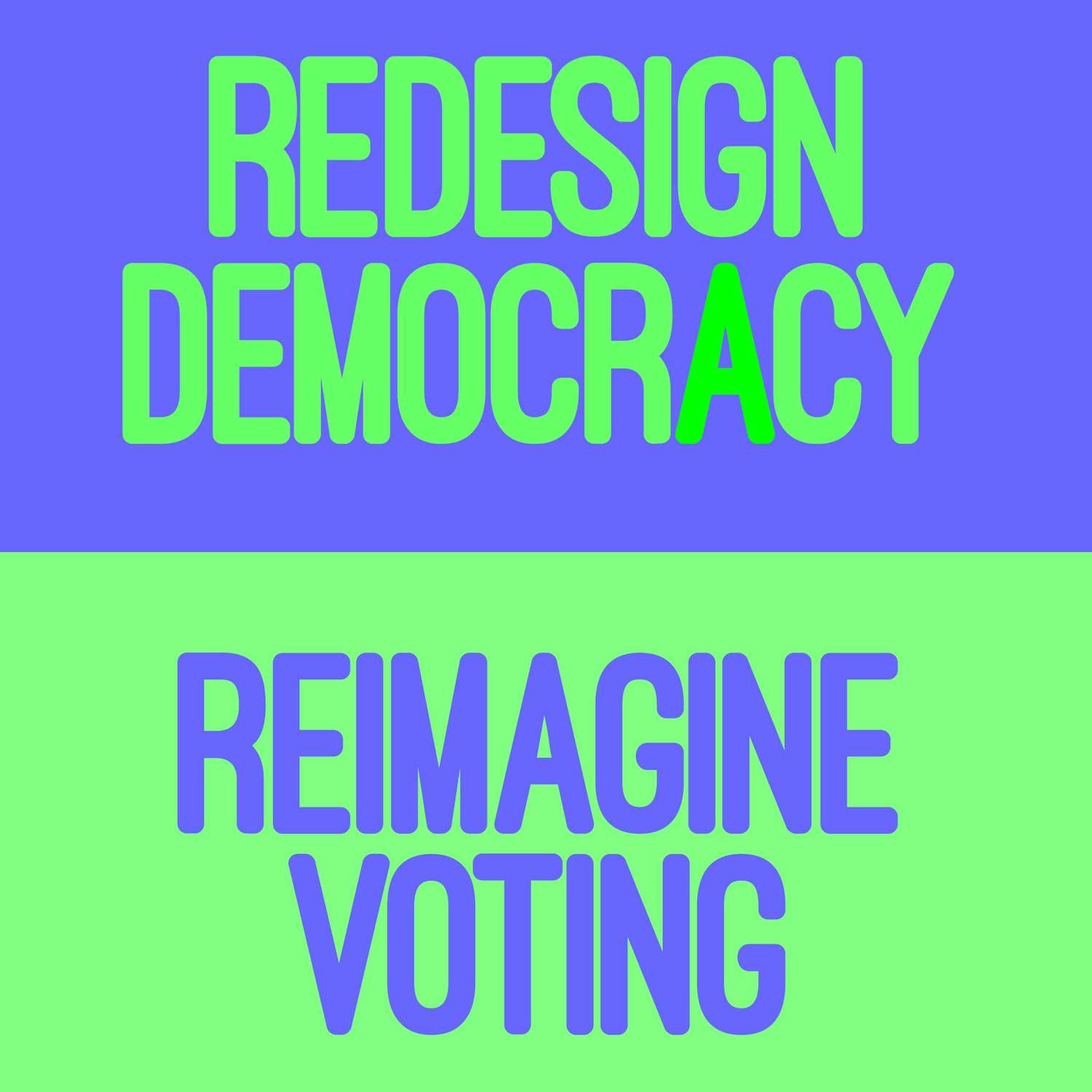























































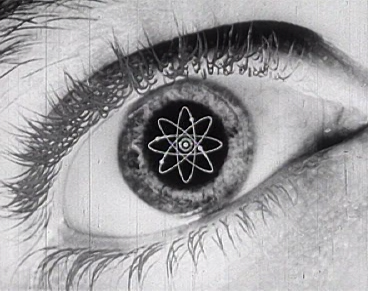
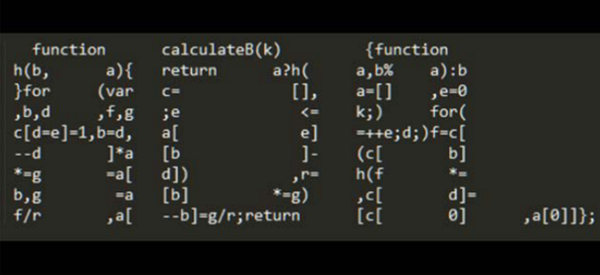
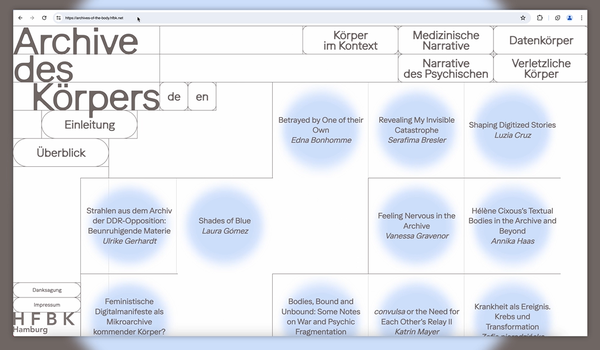



























































































































































 Graduate Show 2025: Don't stop me now
Graduate Show 2025: Don't stop me now
 Lange Tage, viel Programm
Lange Tage, viel Programm
 Cine*Ami*es
Cine*Ami*es
 Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft
Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft
 Kunst im öffentlichen Raum
Kunst im öffentlichen Raum
 How to apply: Studium an der HFBK Hamburg
How to apply: Studium an der HFBK Hamburg
 Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg
 Der Elefant im Raum – Skulptur heute
Der Elefant im Raum – Skulptur heute
 Hiscox Kunstpreis 2024
Hiscox Kunstpreis 2024
 Die Neue Frau
Die Neue Frau
 Promovieren an der HFBK Hamburg
Promovieren an der HFBK Hamburg
 Graduate Show 2024 - Letting Go
Graduate Show 2024 - Letting Go
 Finkenwerder Kunstpreis 2024
Finkenwerder Kunstpreis 2024
 Archives of the Body - The Body in Archiving
Archives of the Body - The Body in Archiving
 Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa
Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa
 Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg
 (Ex)Changes of / in Art
(Ex)Changes of / in Art
 Extended Libraries
Extended Libraries
 And Still I Rise
And Still I Rise
 Let's talk about language
Let's talk about language
 Graduate Show 2023: Unfinished Business
Graduate Show 2023: Unfinished Business
 Let`s work together
Let`s work together
 Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg
 Symposium: Kontroverse documenta fifteen
Symposium: Kontroverse documenta fifteen
 Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image
Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image
 Einzelausstellung von Konstantin Grcic
Einzelausstellung von Konstantin Grcic
 Kunst und Krieg
Kunst und Krieg
 Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun
Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun
 Der Juni lockt mit Kunst und Theorie
Der Juni lockt mit Kunst und Theorie
 Finkenwerder Kunstpreis 2022
Finkenwerder Kunstpreis 2022
 Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule
Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule
 Raum für die Kunst
Raum für die Kunst
 Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg
 Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments
Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments
 Diversity
Diversity
 Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021
Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021
 Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen
Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen
 Schule der Folgenlosigkeit
Schule der Folgenlosigkeit
 Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg
 Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020
Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020
 Digitale Lehre an der HFBK
Digitale Lehre an der HFBK
 Absolvent*innenstudie der HFBK
Absolvent*innenstudie der HFBK
 Wie politisch ist Social Design?
Wie politisch ist Social Design?