Die Tresen-Kolumne: Clean-Desk-Policy
Gestern im Bus mit Freund_innen über den kommenden Abriss des Euler-Hermes-Hochhauses gesprochen. Wir waren uns schnell darüber einig, den Abriss dieses ikonischen Gebäudes in der Mitte von Bahrenfeld zu bedauern. Dieses Bedauern ist wohl auch ein bisschen die Sehnsucht nach urbanen Landmarken und der Renaissance von Klotzästhetiken der Arbeit, die besonders im Milieu der Kulturarbeit gerade wieder aufkommt. Häuser, die manche so auch als Stellvertreter aus Gesellschaftsspielen wie „Hotel“ von MB kannten. Häuser auch, die schon aus der Ferne als Wegweiser dienten. Es ist vielleicht auch ein bisschen die Nostalgie für eine Zeit, in der Menschen in Wohnhäusern oder Wohnungen wohnten und in Gebäuden der Arbeit ihrer Tätigkeit nachgingen (hier fehlen natürlich ganz viele Beschäftigungen, die noch nie in solchen Gebäuden stattgefunden haben). Eine Lebensrealität also, die im Bereich der bildenden Kunst die wenigsten erlebt haben werden. Der Neubau von Euler-Hermes steht schon fast, und an eben diesem Neubau lässt sich die Fransung der Bereiche Arbeit und Leben gut festmachen: ein flaches, robustes Kästchen, schwere und lange Fensterschlitze mit elektrischen Jalousien, gebaut wie ein Parkhaus, mit Säulen und Zwischendecken aus Beton, den Hamburger Arbeiter_innen aber als Geschenk in eine dünne Schicht aus Klinker verpackt. Solche Gebäude stehen überall. Sie sind weder schön noch hässlich, entziehen sich fast einer ästhetischen Bewertung. Die neuen Siedlungskomplexe, Eigentumswohnblöcke für Student_innen, aber auch Einfamilienhäuser, die gerade deutschlandweit errichtet werden, orientieren sich an diesen neuen Standards des Bauens. Auch was die Materialauswahl angeht, gibt es zwischen Stadt und Peripherie immer größere Überschneidungen. Hochdrucklaminierte Kunststoffplatten mit aufgedrucktem Stein- und Holzmuster erleichtern die Mühsal einer Assemblage unterschiedlicher Materialitäten. Man braucht nur noch einen gegossenen Kubus und eine Reihe von Keilleisten, um die Außenhaut einzuhängen. Eine Technik aus der künstlerischen Praxis: Zeitgenössische Häuser, das sind eben auch einfach Stahlbetondisplays, behangen mit den neuesten Werken des Baustoffhandels. Und wie eben auch in der Kunst, sind diese Werke oftmals Referenzen auf historische Vorbilder. In meiner Küche liegt ein Boden aus PVC, bedruckt mit einem Foto von Laminat, welches rohgesägtes Eichenholz imitiert: ein ganzer Stammbaum westlicher Fußbodengeschichte. Arbeits- und Wohnarchitekturen verschmelzen ästhetisch zu einer Erzählung, in der die Grenzen zwischen „zuhause“ und „bei der Arbeit“ verschwimmen. Vielleicht kommt auch daher die ein wenig schizophrene Nostalgie von mir und meinen Kolleg_innen der Kunst. Die alten Gebäude der verhassten Arbeit waren klare hierarchische Pyramiden: oben der Chef, unten die Abteilungen. An ihren Büroplätzen konnte sich der kleine Bruch mit dieser Hierarchie und das Bewusstsein, einer zeitlich und geistig begrenzten Arbeit nachzugehen, durch Dekorationen, persönliche Pflanzen und Bilder von Bezugspersonen manifestieren. Die Erinnerung, dass man hier auch wieder rauskommt. Das neue und flache Gebäude verschleiert die Existenz dieser Hierarchien, und die neue „Clean-Desk-Policy“ verhindert die Raumnahme durch die entbehrlichen Angestellten. Deine Arbeit ist dort, wo dein Laptop ist. Also in der Cafeteria, dem Atrium, dem Zug, zuhause. Klingt wie mein Alltag.
















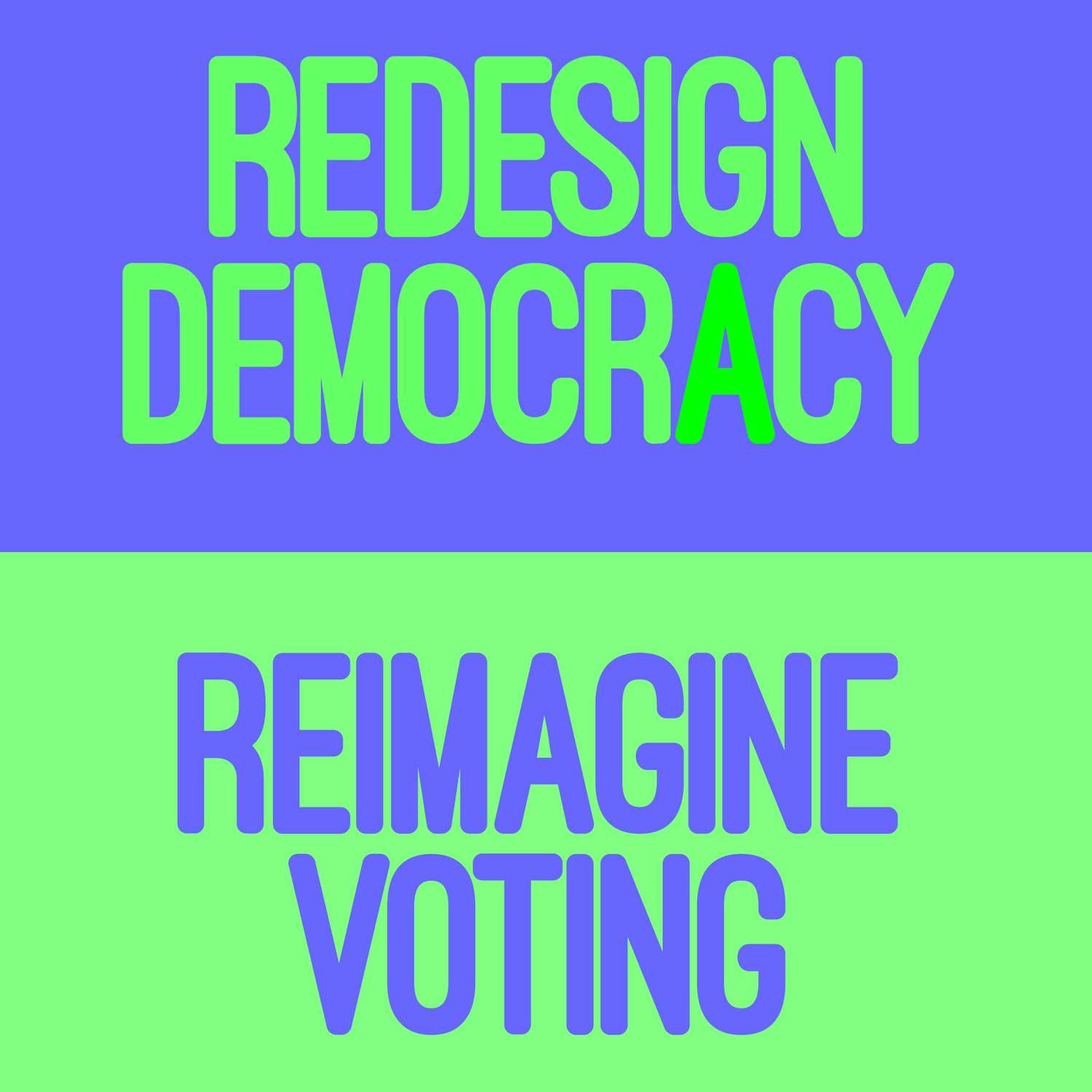























































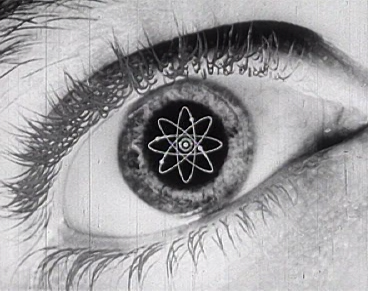
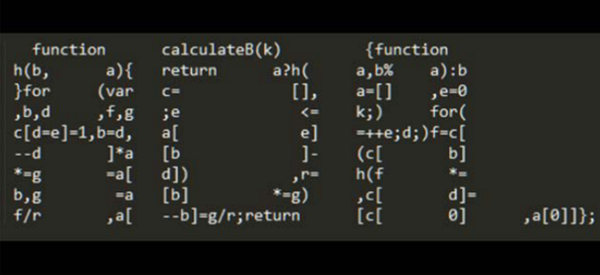
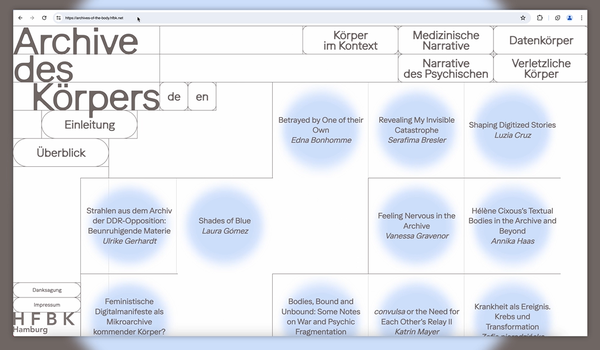



























































































































































 Graduate Show 2025: Don't stop me now
Graduate Show 2025: Don't stop me now
 Lange Tage, viel Programm
Lange Tage, viel Programm
 Cine*Ami*es
Cine*Ami*es
 Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft
Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft
 Kunst im öffentlichen Raum
Kunst im öffentlichen Raum
 How to apply: Studium an der HFBK Hamburg
How to apply: Studium an der HFBK Hamburg
 Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg
 Der Elefant im Raum – Skulptur heute
Der Elefant im Raum – Skulptur heute
 Hiscox Kunstpreis 2024
Hiscox Kunstpreis 2024
 Die Neue Frau
Die Neue Frau
 Promovieren an der HFBK Hamburg
Promovieren an der HFBK Hamburg
 Graduate Show 2024 - Letting Go
Graduate Show 2024 - Letting Go
 Finkenwerder Kunstpreis 2024
Finkenwerder Kunstpreis 2024
 Archives of the Body - The Body in Archiving
Archives of the Body - The Body in Archiving
 Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa
Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa
 Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg
 (Ex)Changes of / in Art
(Ex)Changes of / in Art
 Extended Libraries
Extended Libraries
 And Still I Rise
And Still I Rise
 Let's talk about language
Let's talk about language
 Graduate Show 2023: Unfinished Business
Graduate Show 2023: Unfinished Business
 Let`s work together
Let`s work together
 Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg
 Symposium: Kontroverse documenta fifteen
Symposium: Kontroverse documenta fifteen
 Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image
Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image
 Einzelausstellung von Konstantin Grcic
Einzelausstellung von Konstantin Grcic
 Kunst und Krieg
Kunst und Krieg
 Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun
Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun
 Der Juni lockt mit Kunst und Theorie
Der Juni lockt mit Kunst und Theorie
 Finkenwerder Kunstpreis 2022
Finkenwerder Kunstpreis 2022
 Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule
Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule
 Raum für die Kunst
Raum für die Kunst
 Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg
 Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments
Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments
 Diversity
Diversity
 Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021
Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021
 Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen
Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen
 Schule der Folgenlosigkeit
Schule der Folgenlosigkeit
 Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg
 Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020
Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020
 Digitale Lehre an der HFBK
Digitale Lehre an der HFBK
 Absolvent*innenstudie der HFBK
Absolvent*innenstudie der HFBK
 Wie politisch ist Social Design?
Wie politisch ist Social Design?