Auf rhizome.hfbk.net: 3 Notizen zum Baakenpark
Eröffnung Baakenpark, Hafencity, 6. Mai 2018
1
Kinderprogramm, Swingkurs, Kinoleinwand, Sofakonzerte – Die Hafencity fuhr die ganz großen Geschütze auf, um die Eröffnung des neu gestalteten Baakenhafens am Ostende des Stadtentwicklungsgebiets zu feiern. Hier, am letzten Ende, kurz vor den Elbbrücken, will die als elitär verschriene Hafencity endlich alles richtig machen – und leistet sich deshalb nicht nur geförderte Wohnungen und eine extra aufgeschüttete Grünfläche samt Kita und „Himmelsberg“, sondern ein Fest für die ganze Familie. Sogar einige Bewohner der nebenan gelegenen Flüchtlingsunterkunft waren anwesend und durften Falafel verkaufen.
2
Auch Kunst kommt im großen neuen Plan natürlich vor. Nicht nur sind zwei begehbare Großskulpturen von Thomas Schütte im Baakenpark geplant – diese „Tower of Talkers“ sollen laut Ursprungsentwurf sogar ein Café beherbergen – mit Ellen Blumenstein hat man letztes Jahr sogar eine eigene Stadtteilkuratorin für die HafenCity installiert. Kultur soll schließlich die Belebung des „Urbanen Dorfs“ (Prospekttext) beschleunigen, mit der es bisher in der immer mit Touristen vollen, aber in der Bevölkerung wenig angenommenen Hafencity immer gehapert hat. Auch dem geglückten Kunstprojekt „Park Fiction“ war es schließlich ein Park mit Skulpturen, der die Lebensqualität im Stadtteil durchaus erhöht hat.
3
Kunst im urbanen Raum ist in der stark durchkommerzialisierten Umgebung der postmodernen Stadt immer der Gefahr der Instrumentalisierung durch eben diese kommerziellen Interessen ausgesetzt, schreibt Uwe Lewitzky bezugnehmend auf Frederic Jameson in „Kunst für Alle“. Und anders als Park Fiction war der Baakenpark kein partizipatives Projekt, verfügt die Hafencity über kein widerständiges Bewohnernetzwerk, welches sich die Kunst aneignet, in den entsprechenden Kontext setzt. Ist der durchgestylte Baakenpark letzlich wirklich erfolgreicher Anwohnertreffpunkt oder doch nur eine Attraktion mehr für das Hamburgtourismus-Portfolio? Es bleibt abzuwarten. Weit schlimmer scheint angesichts der sterilen Umgebung sowieso eine andere Gefahr: funktioniert hier am Ende die Kunst nicht als Inklusionsmotor, sondern – wie die klassische Musik in der Bahnhofshalle – nicht eher als Ausschlussmechanismus?









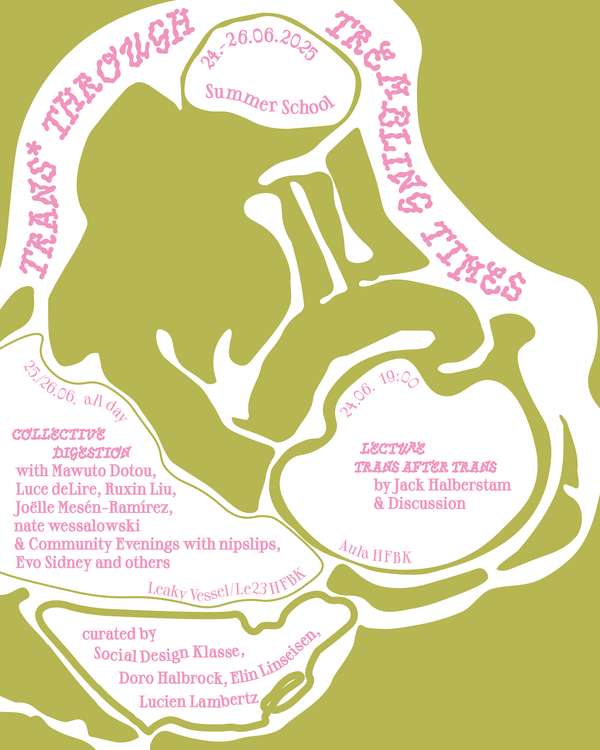





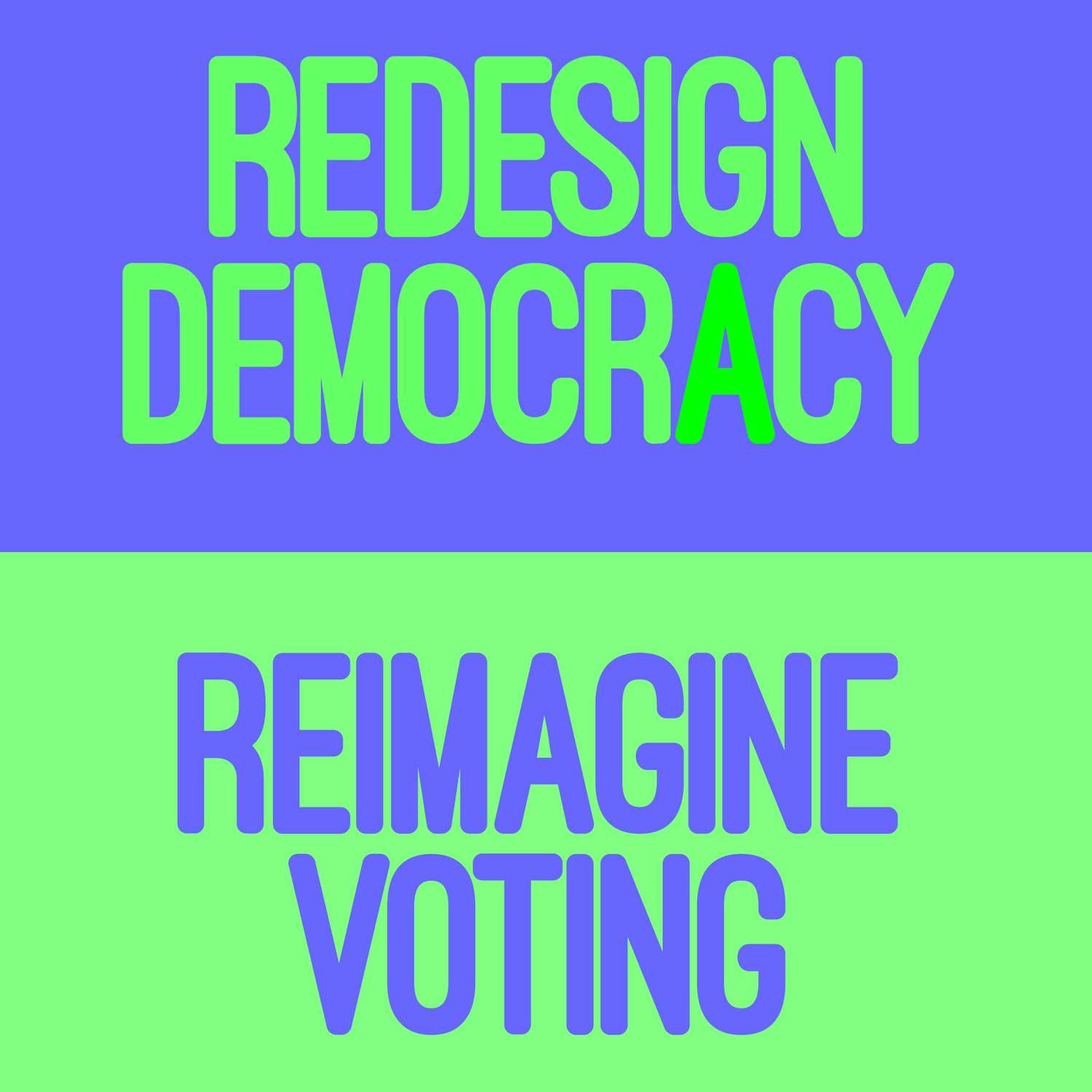











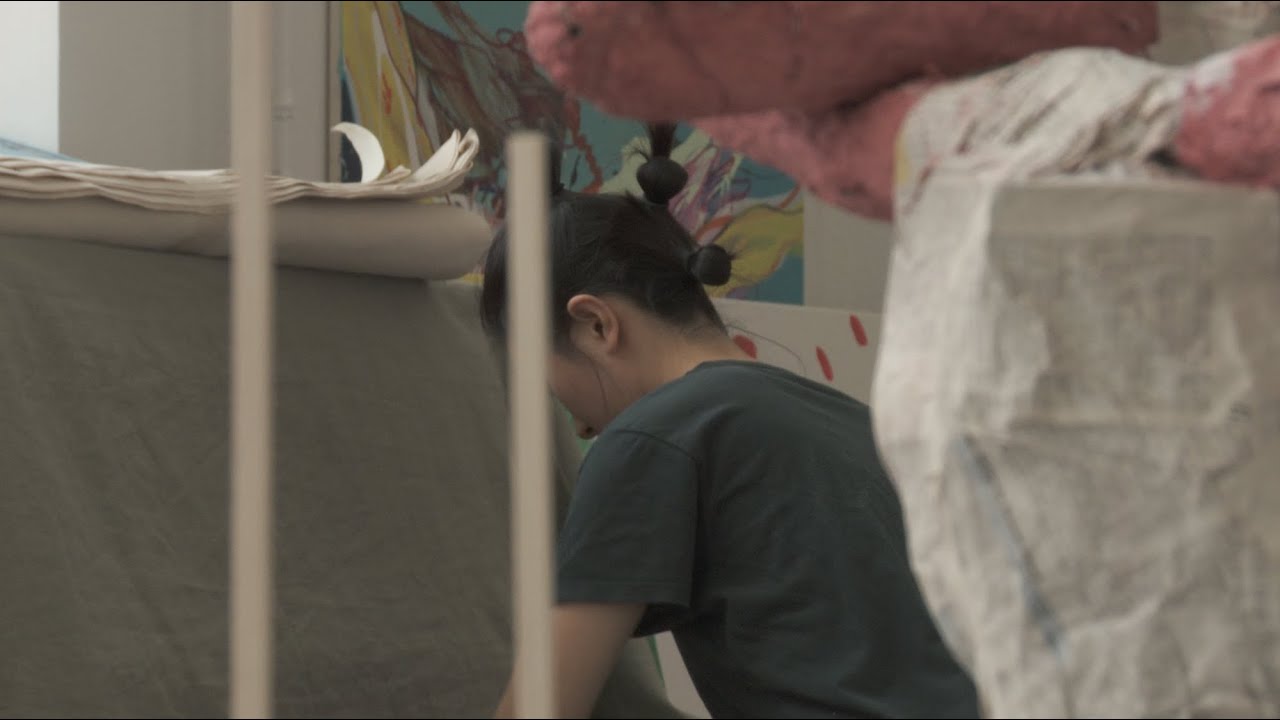






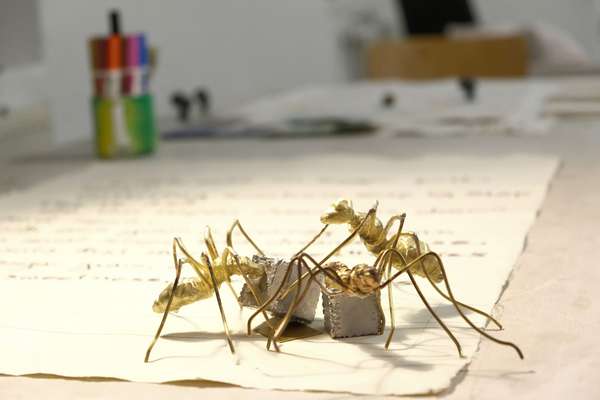



















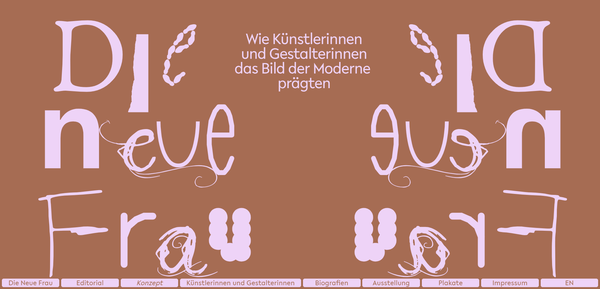
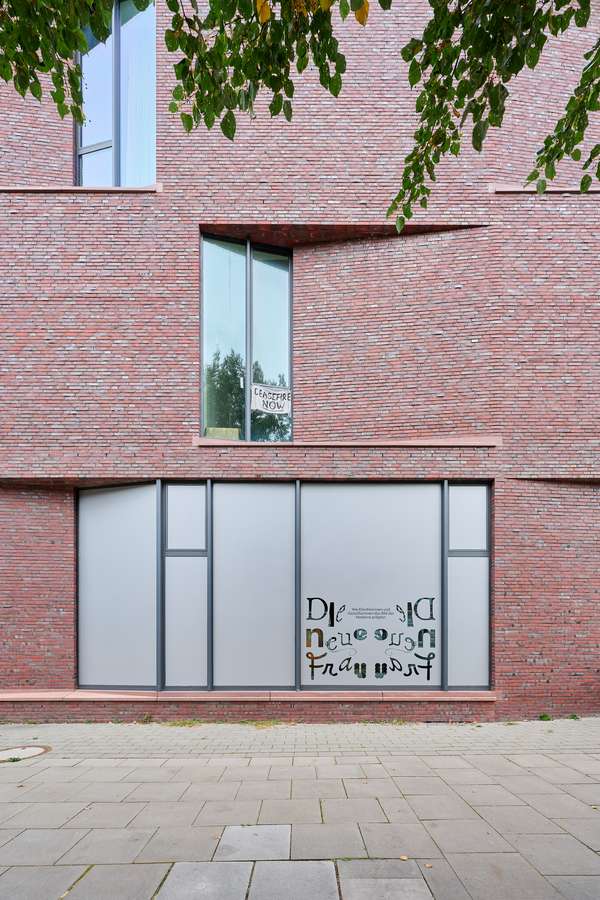



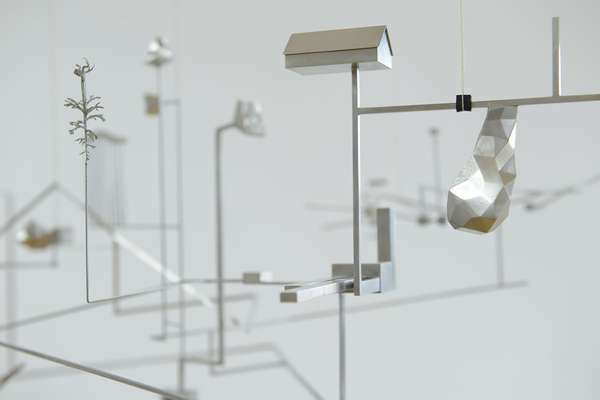











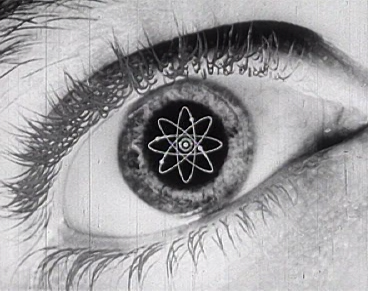
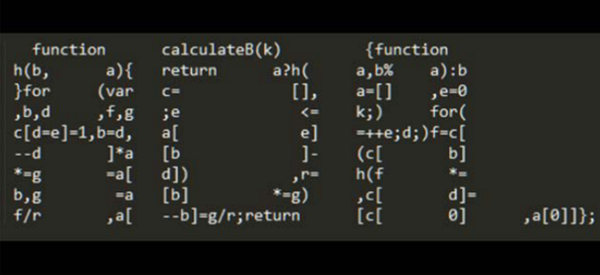
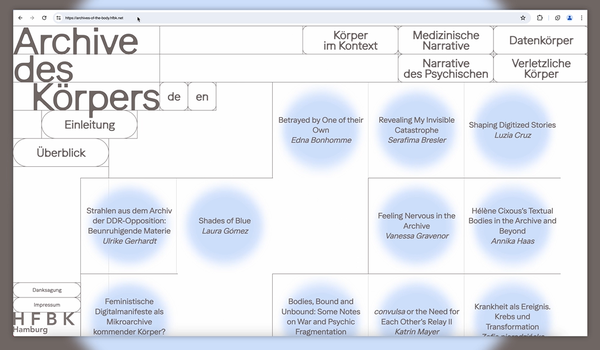
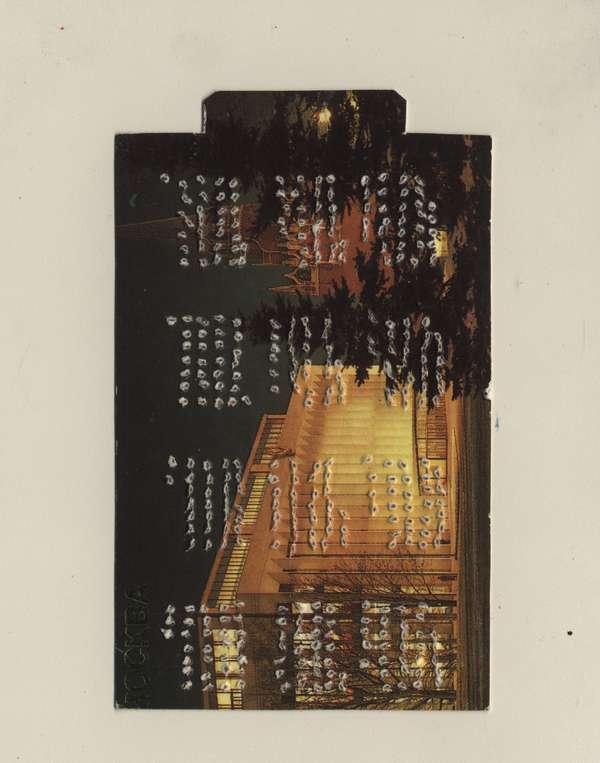
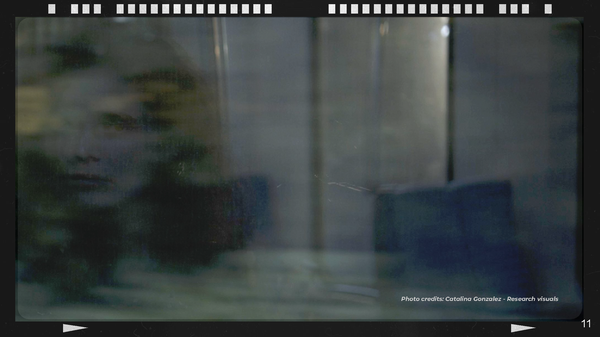



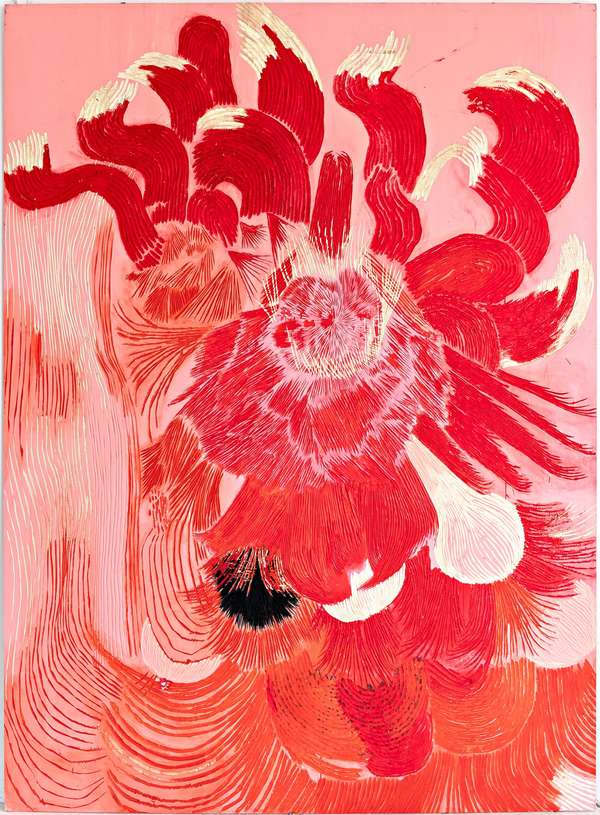







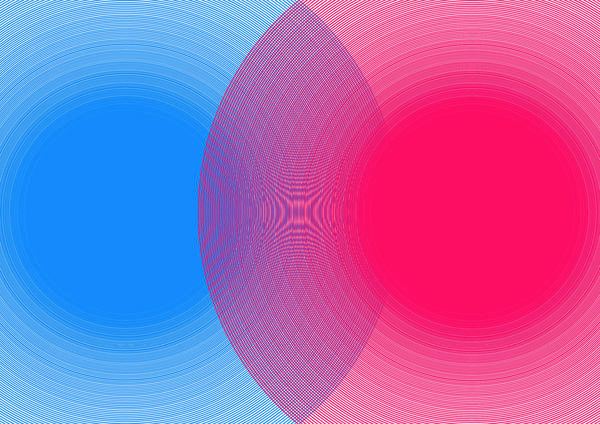






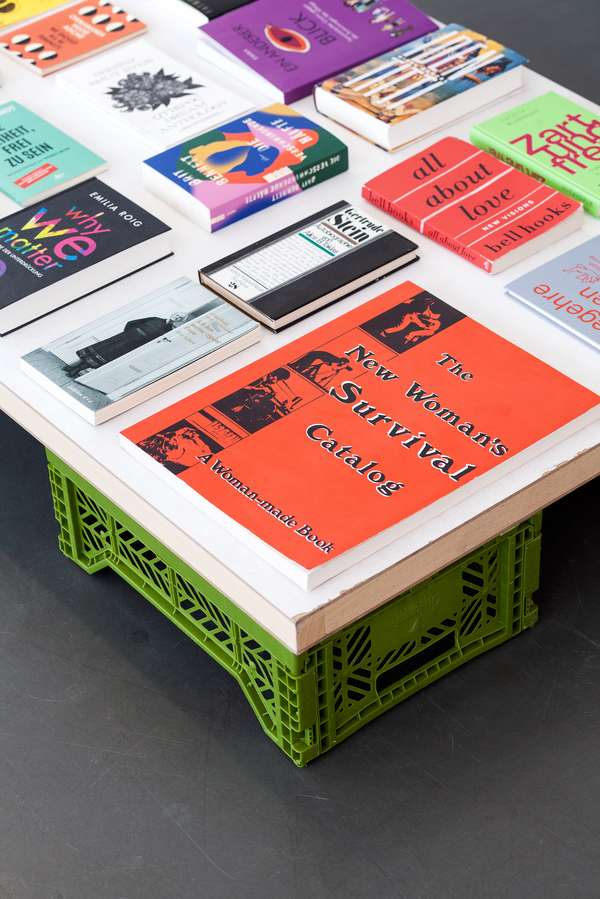



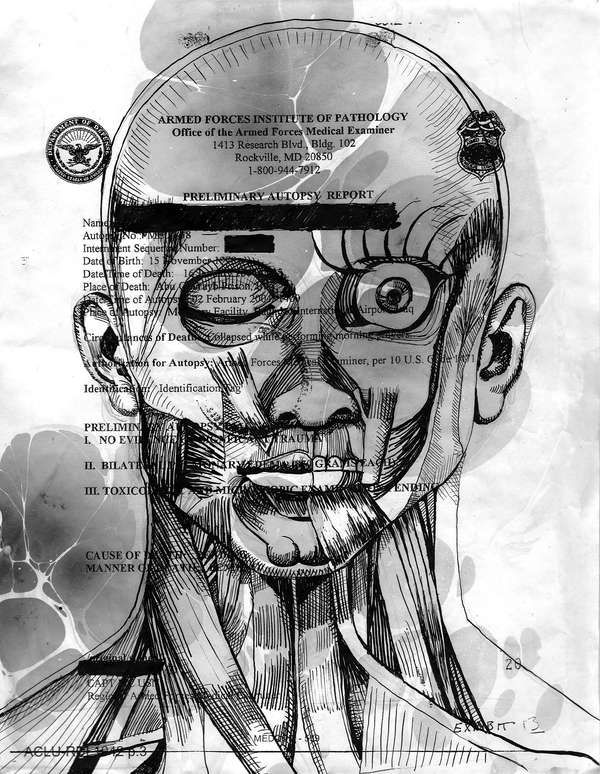

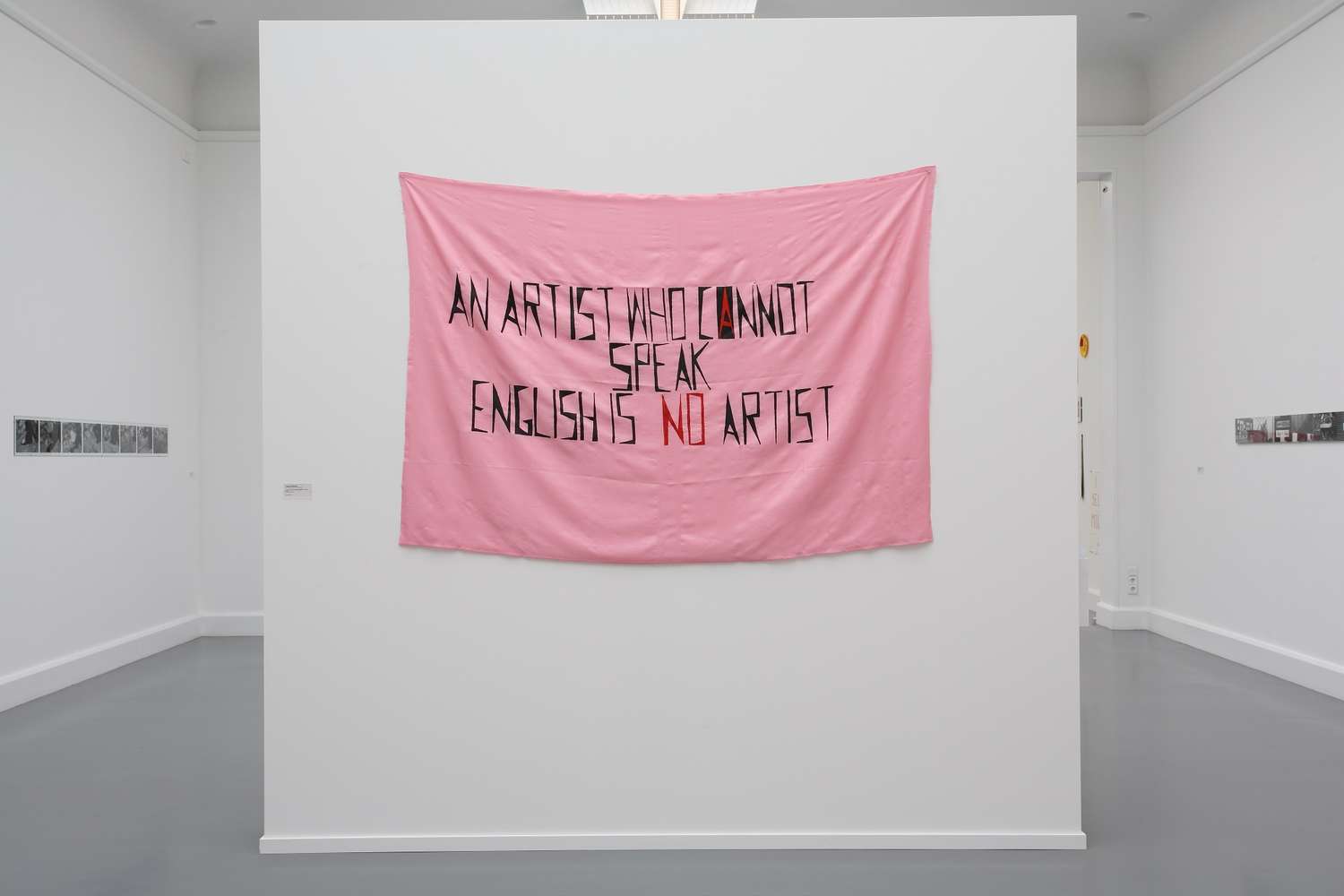

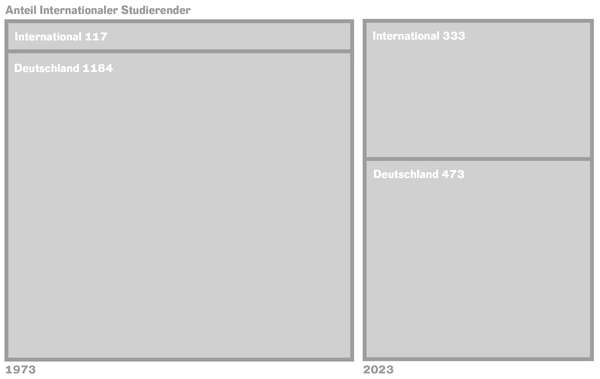
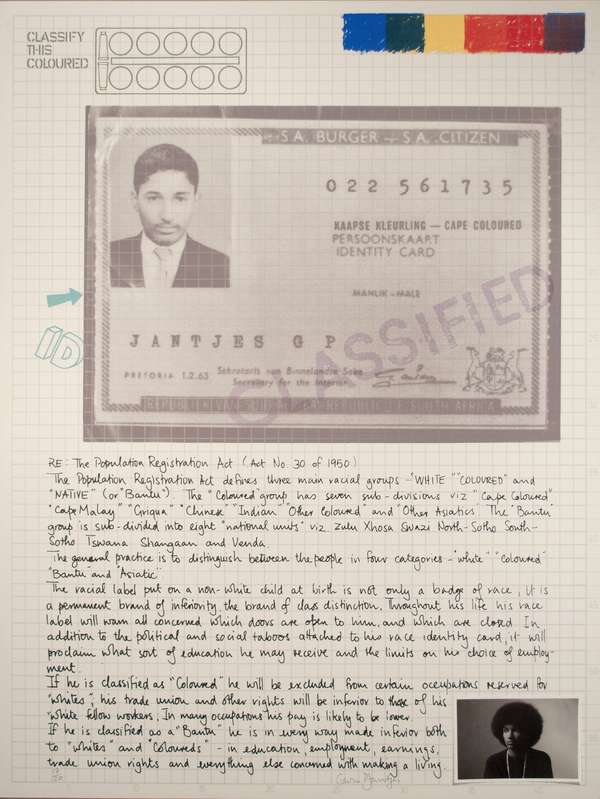
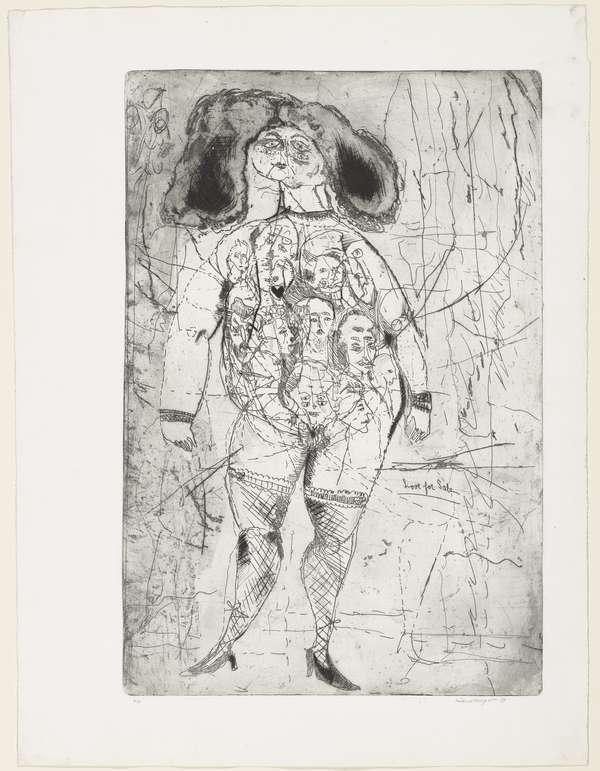
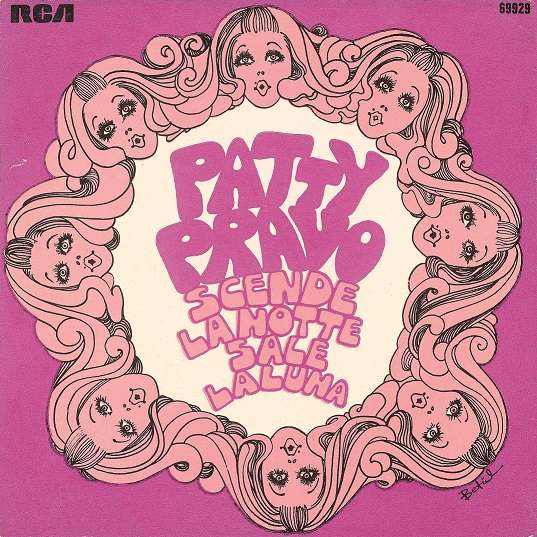





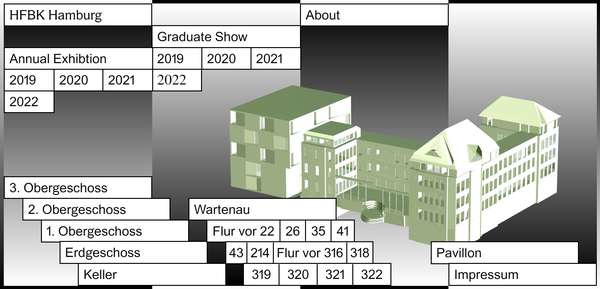
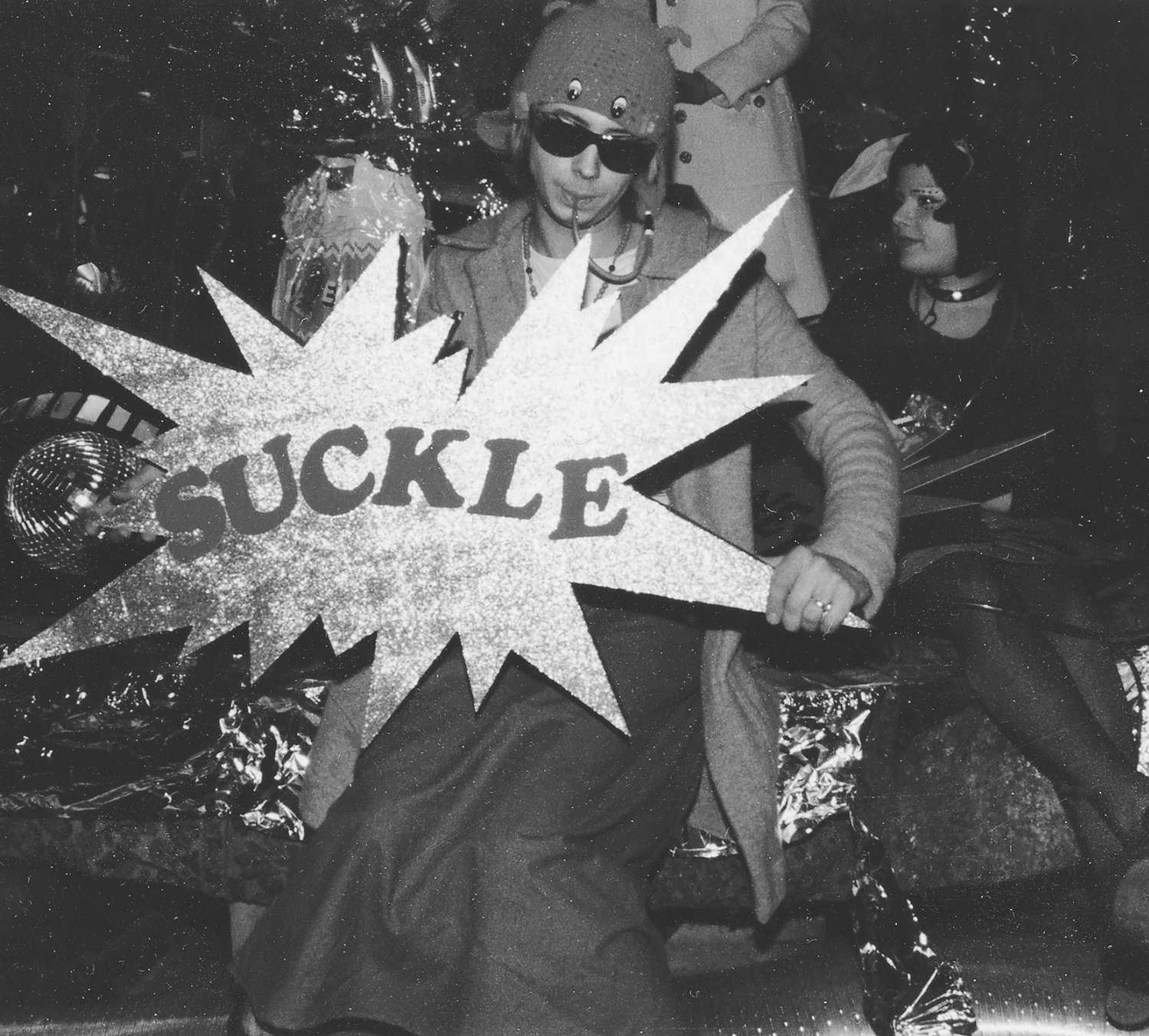



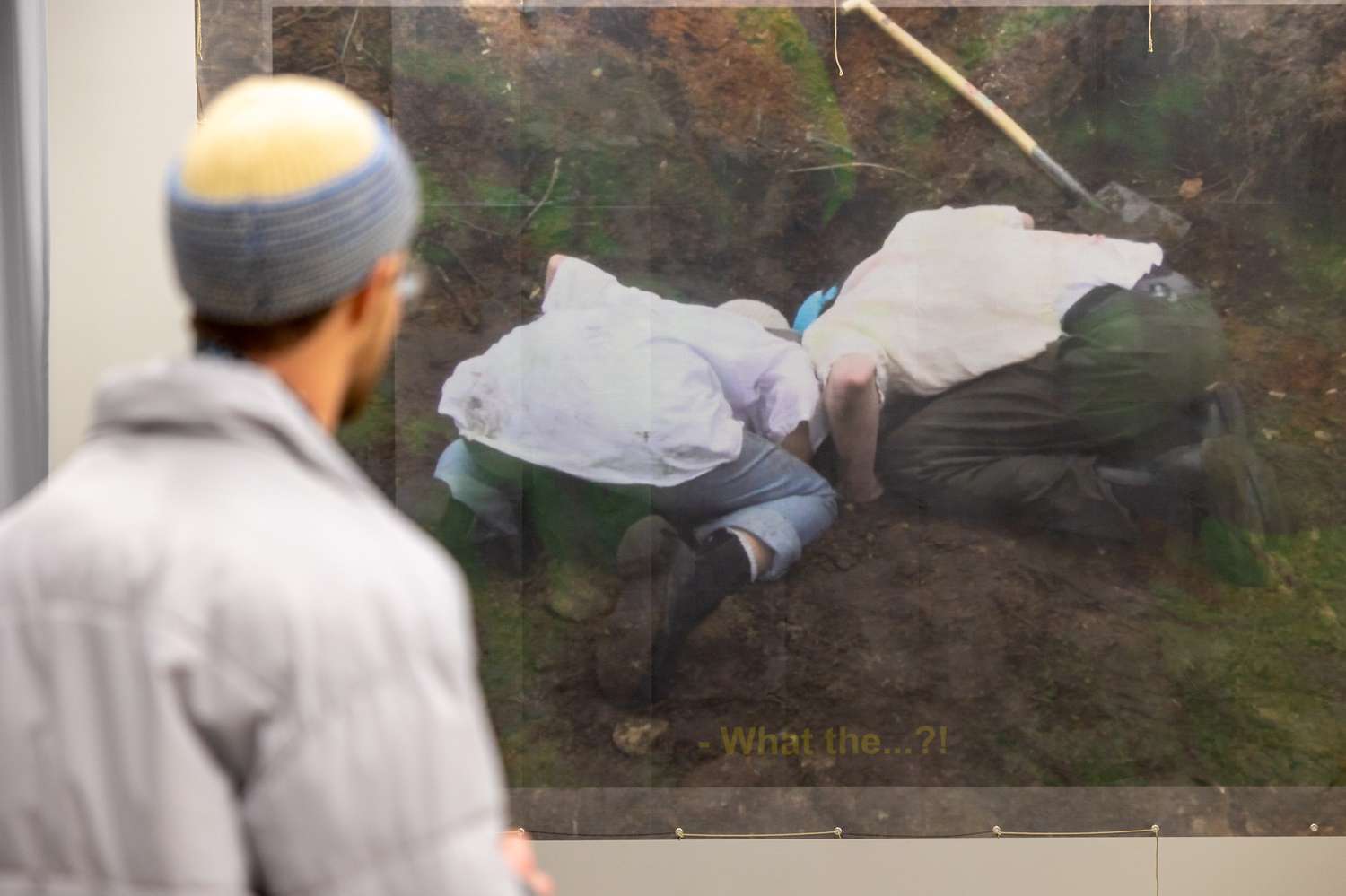


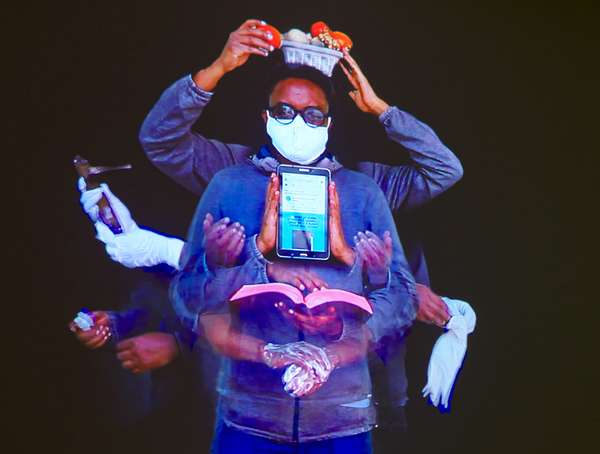
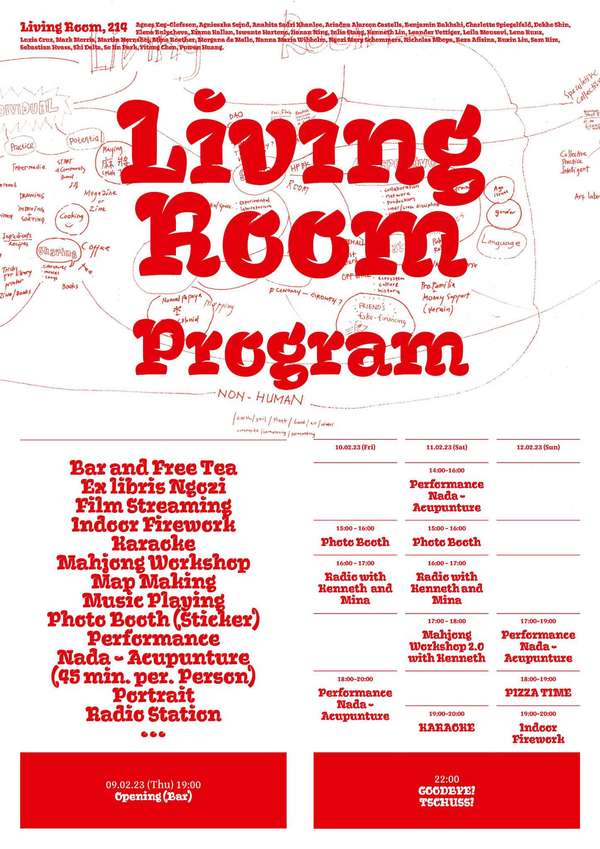
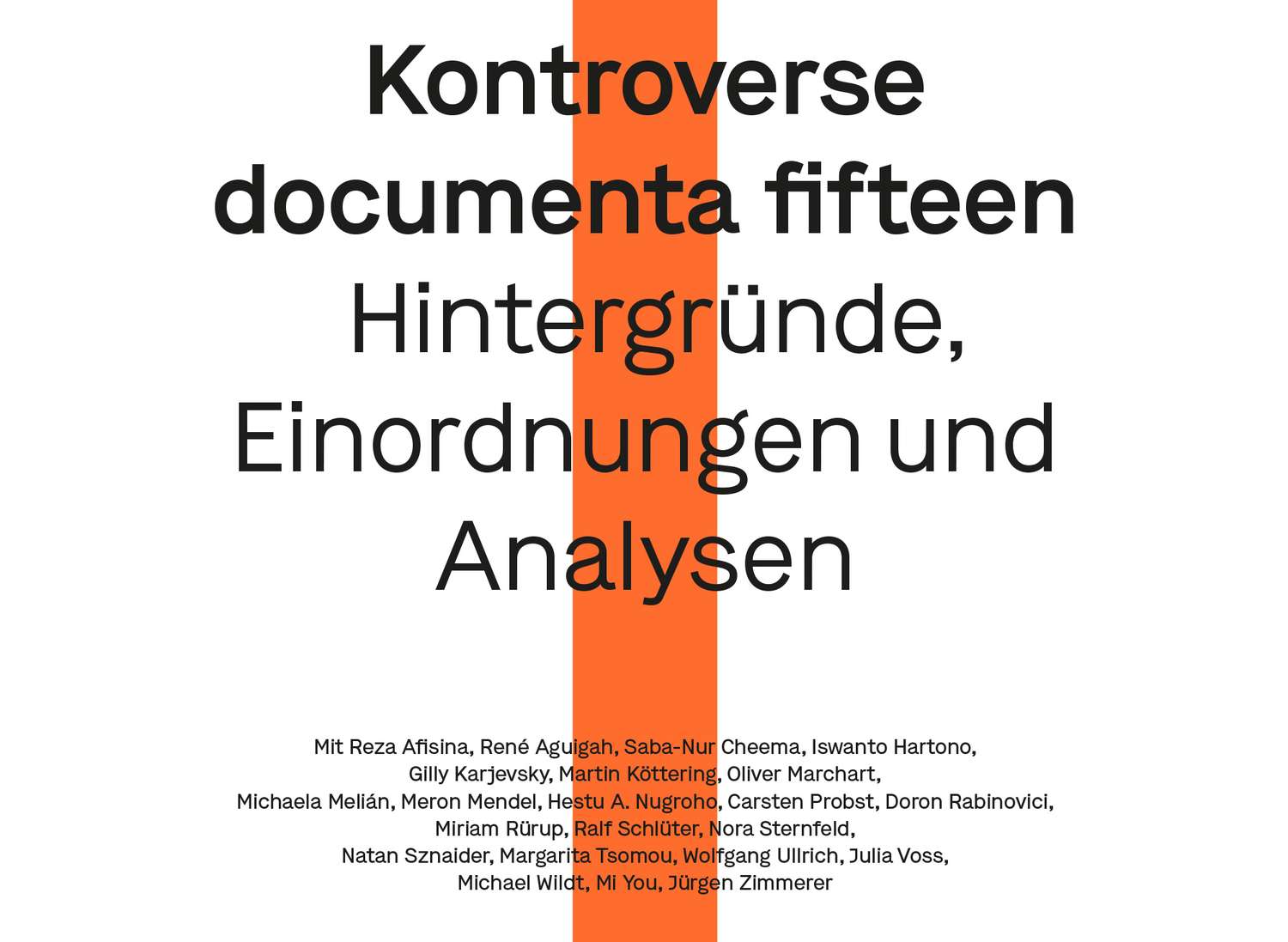




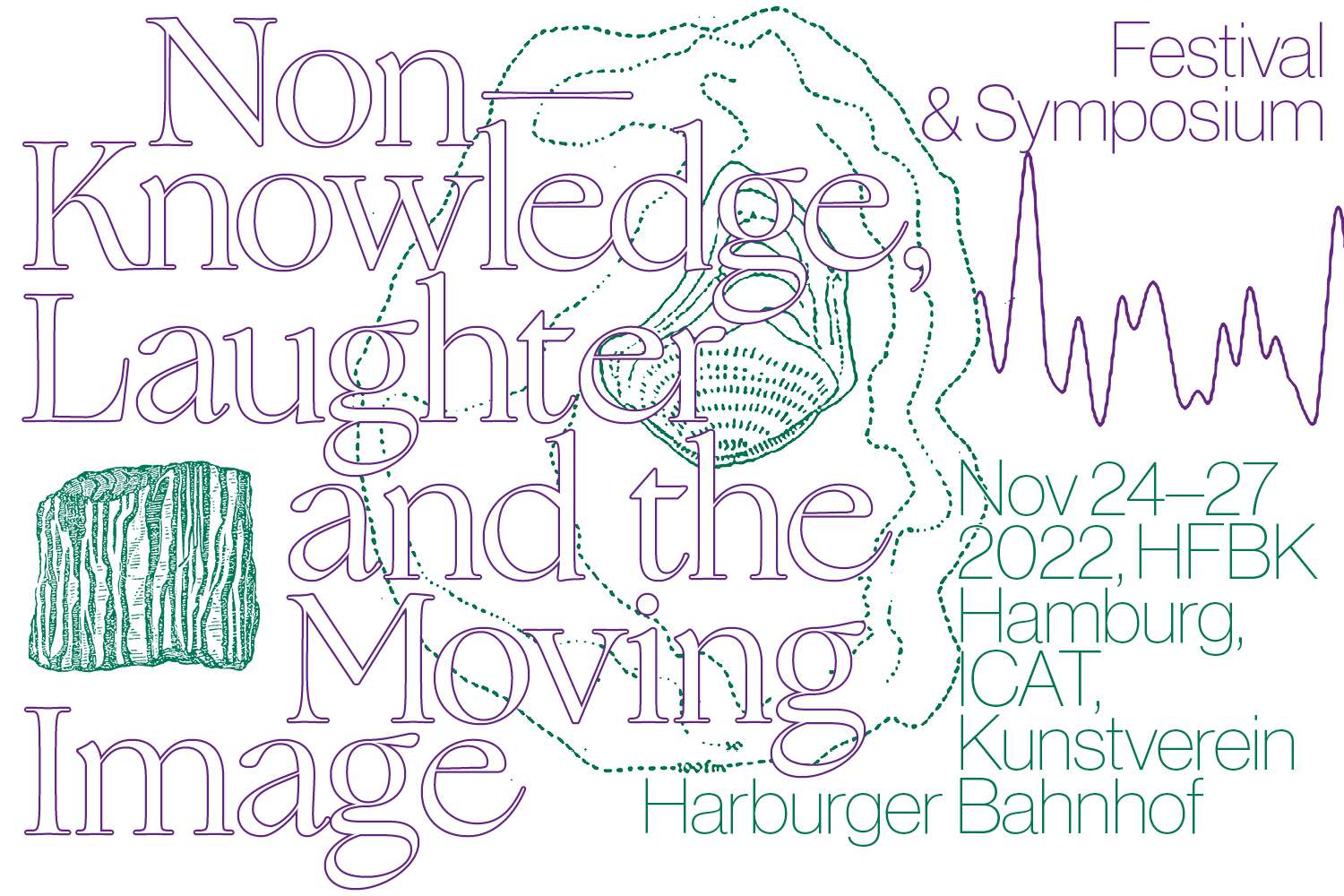









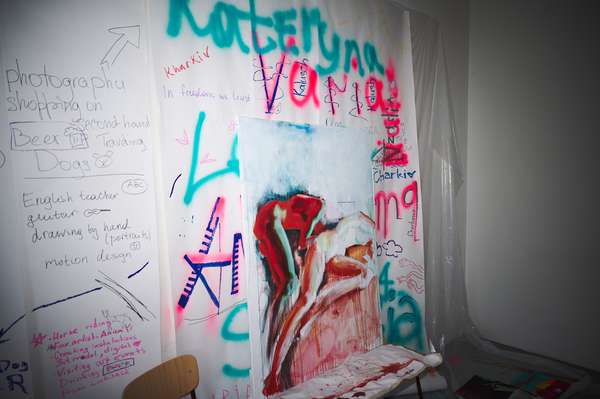




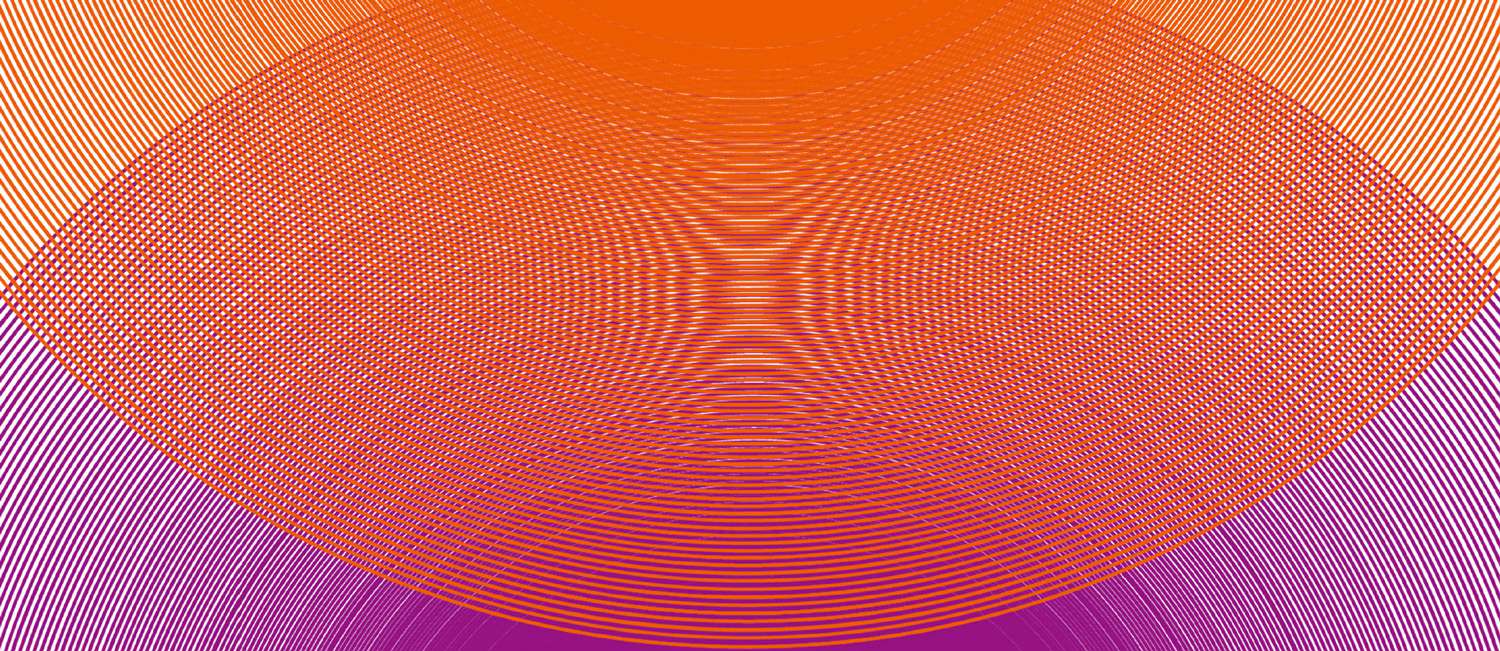
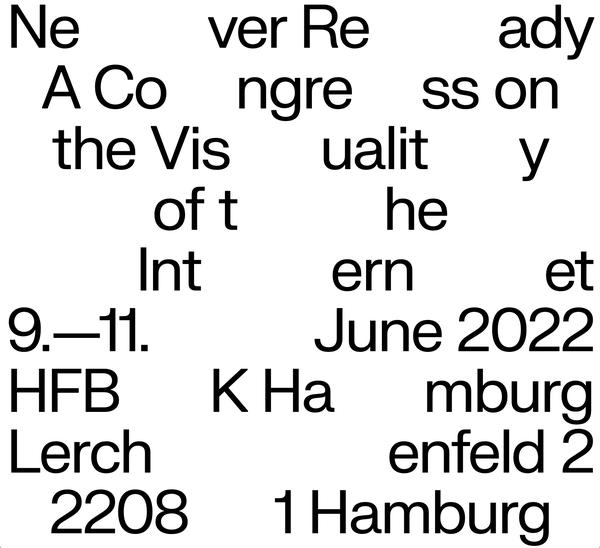
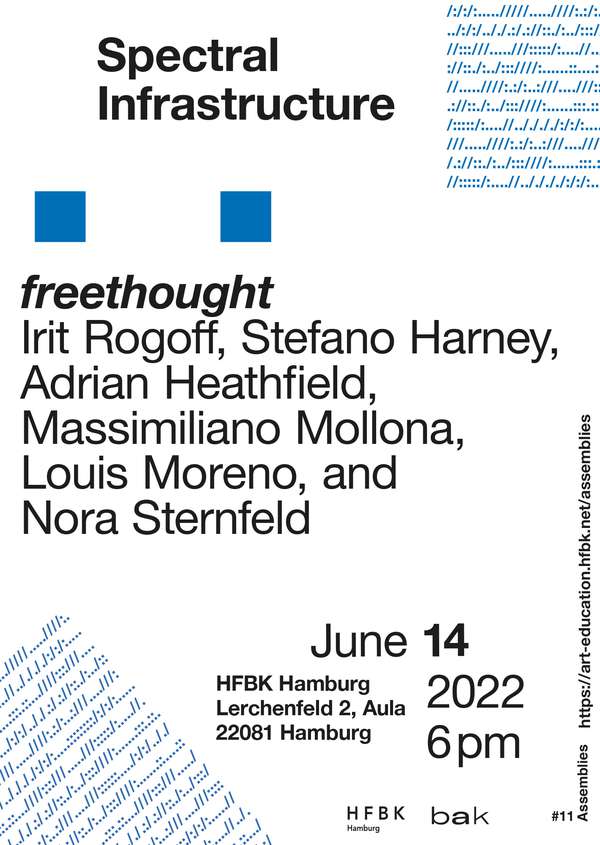

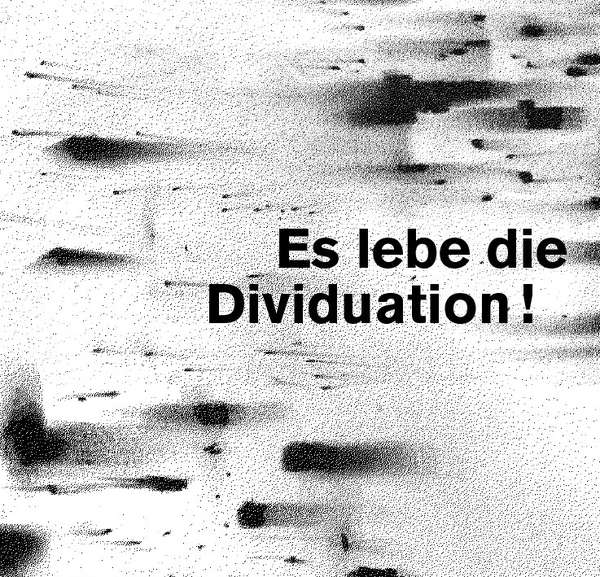
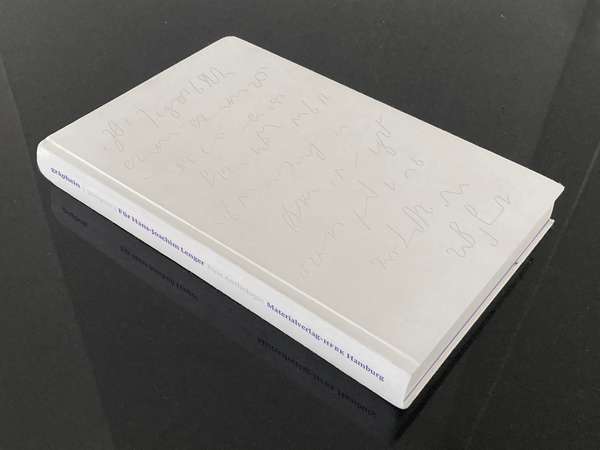
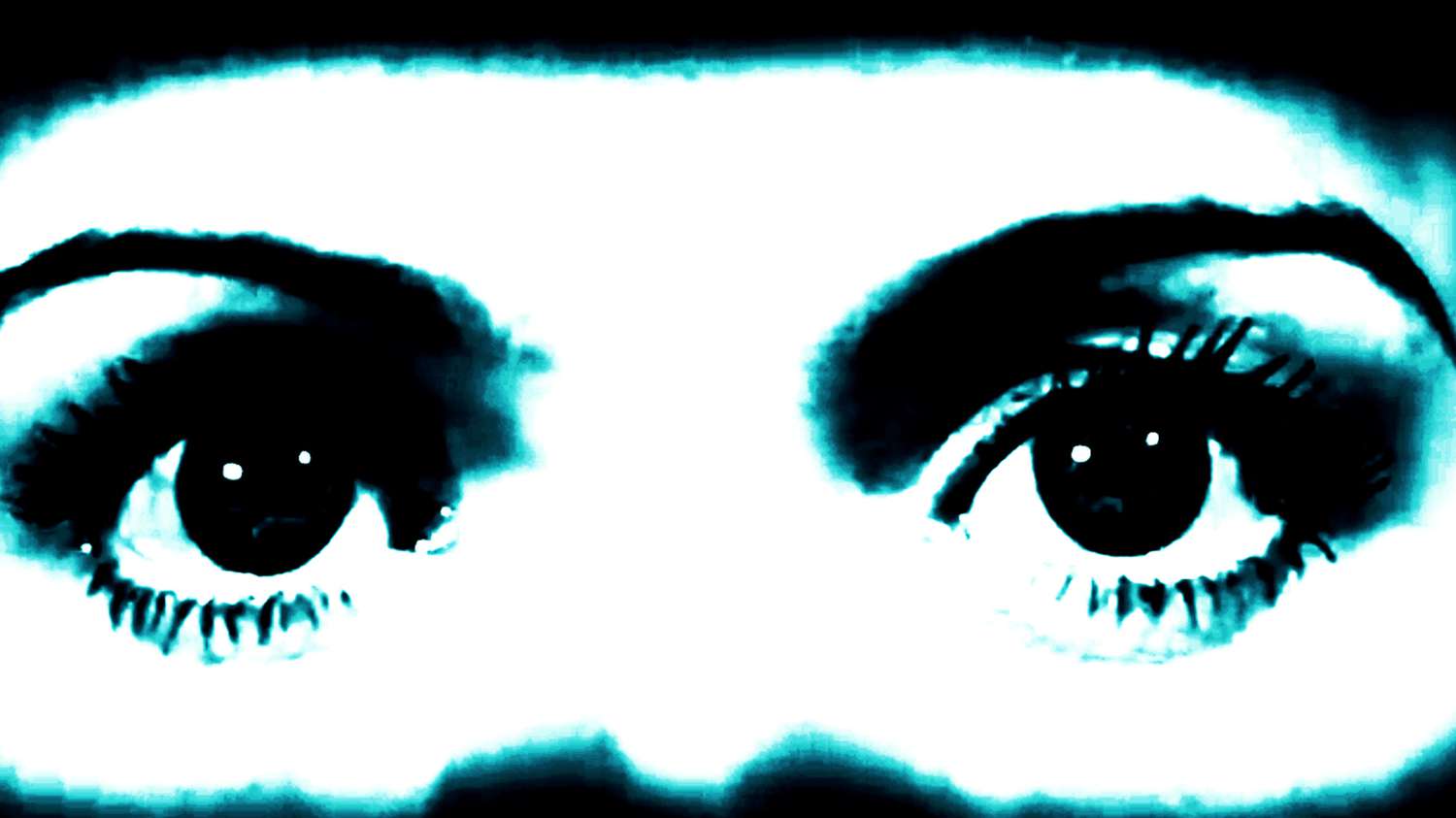
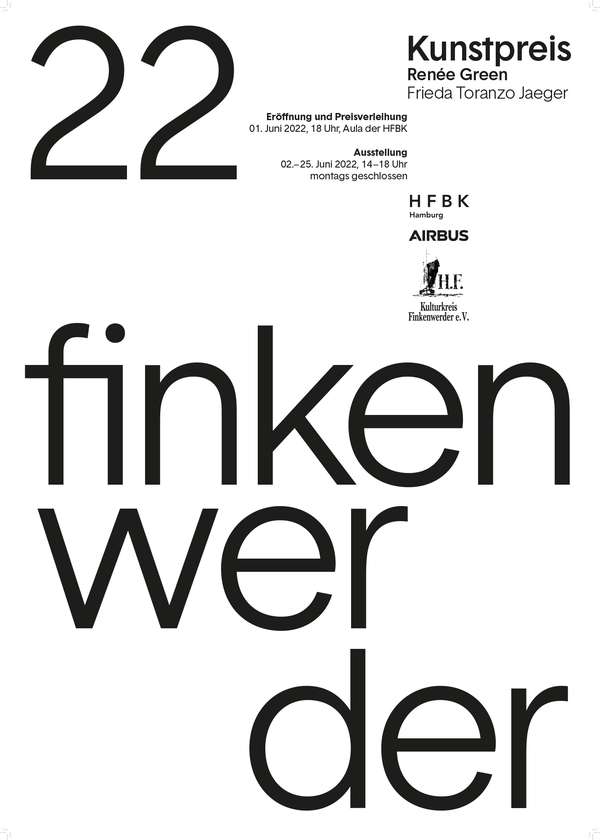















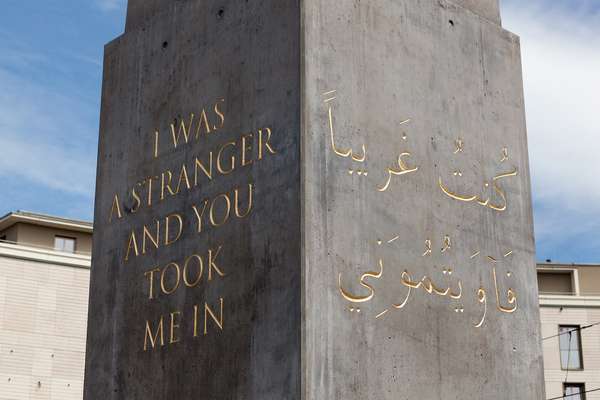
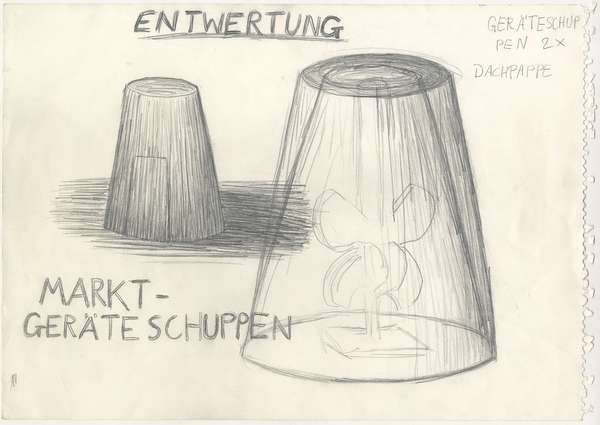
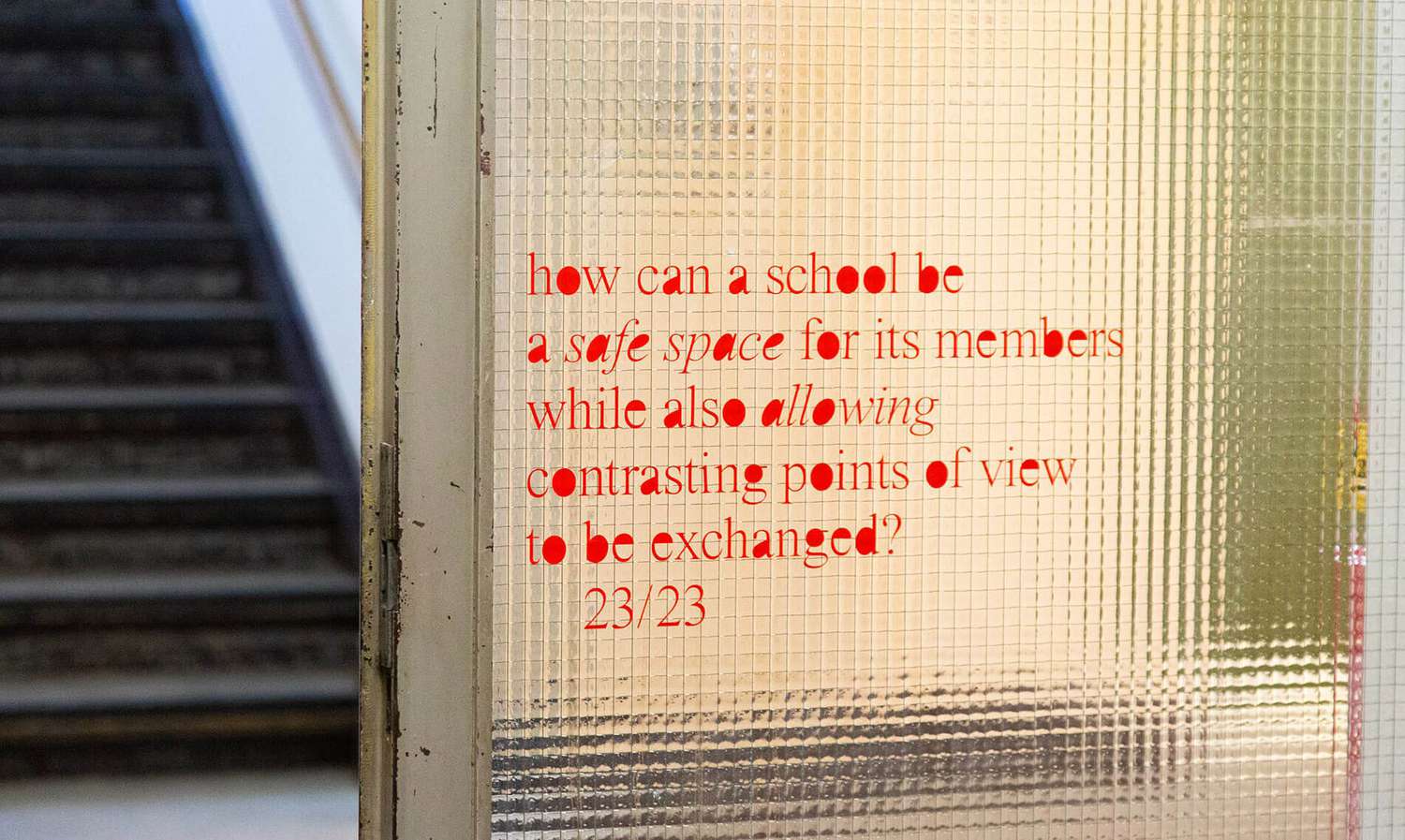

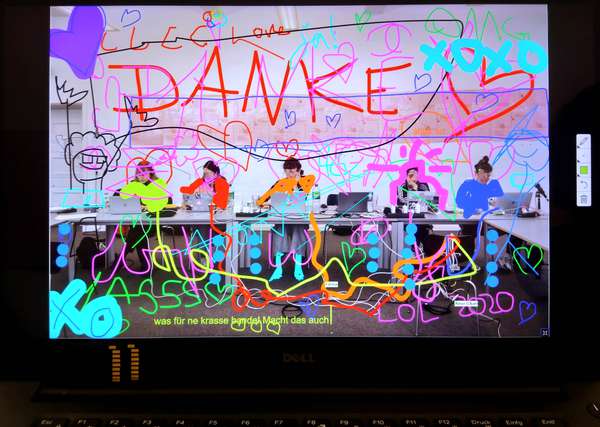
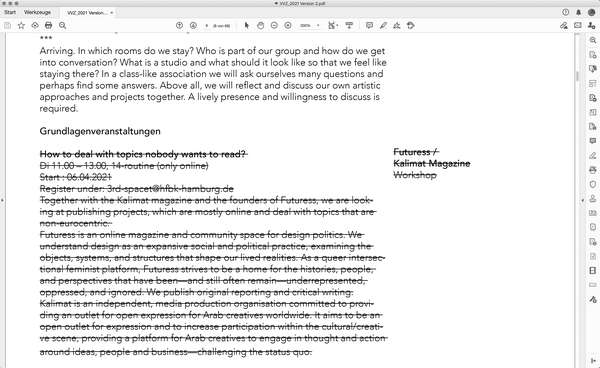
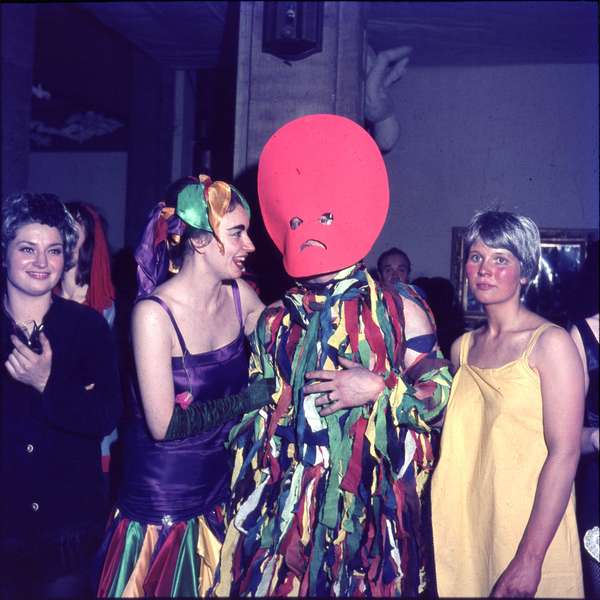





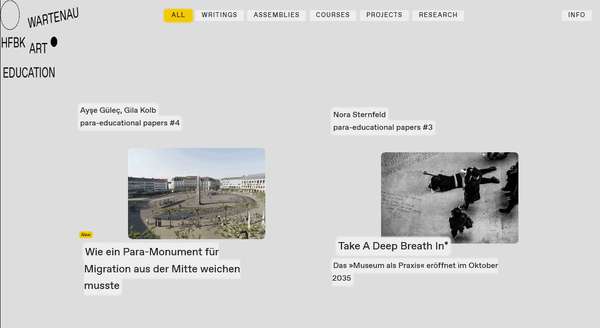

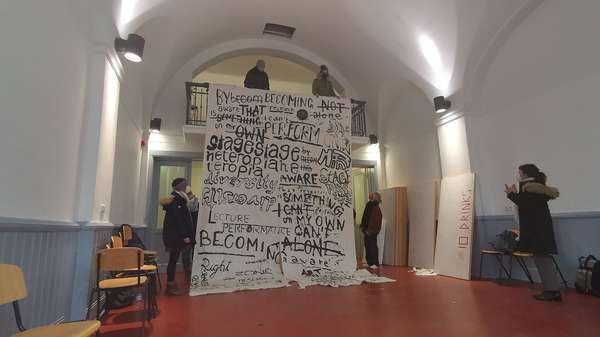
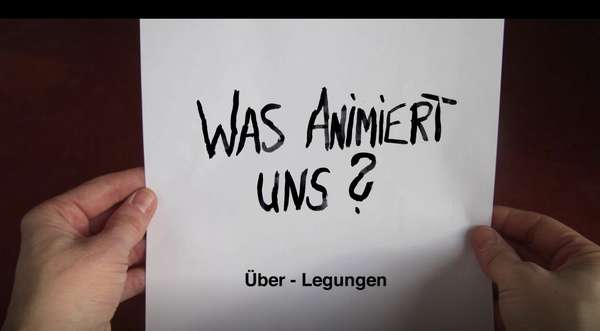





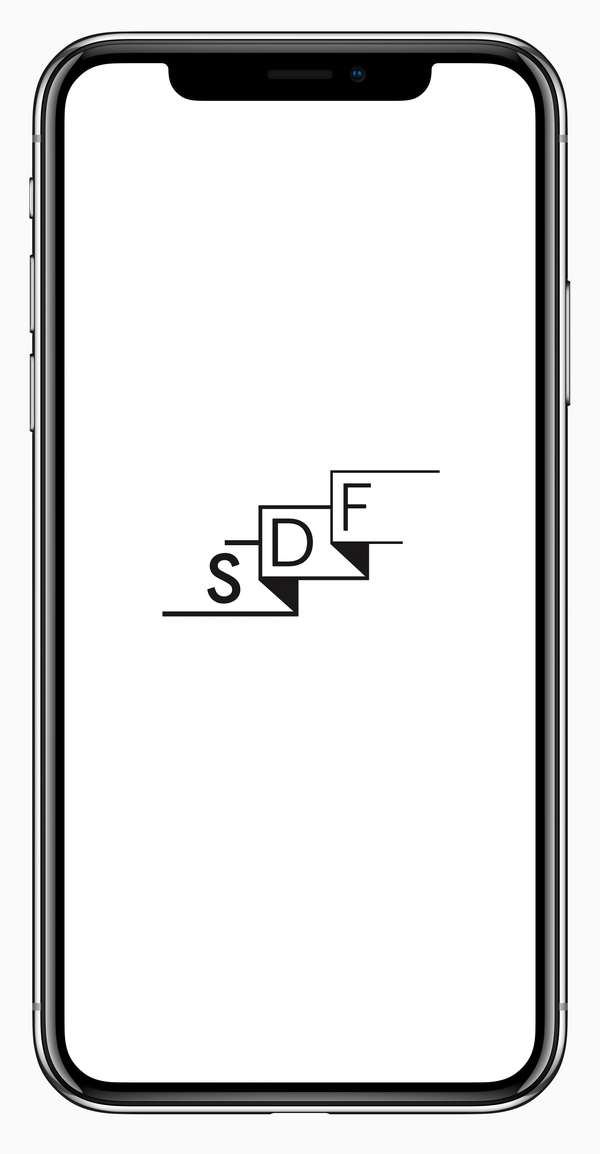
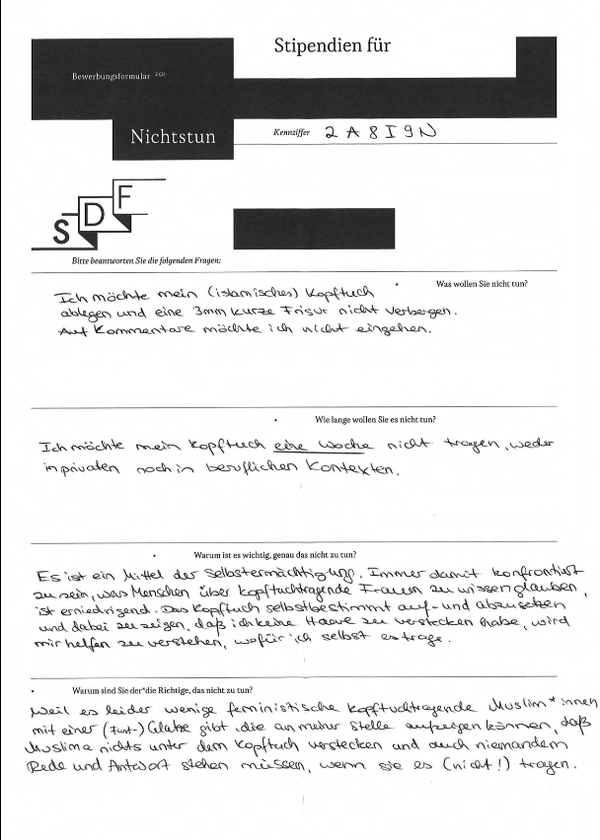


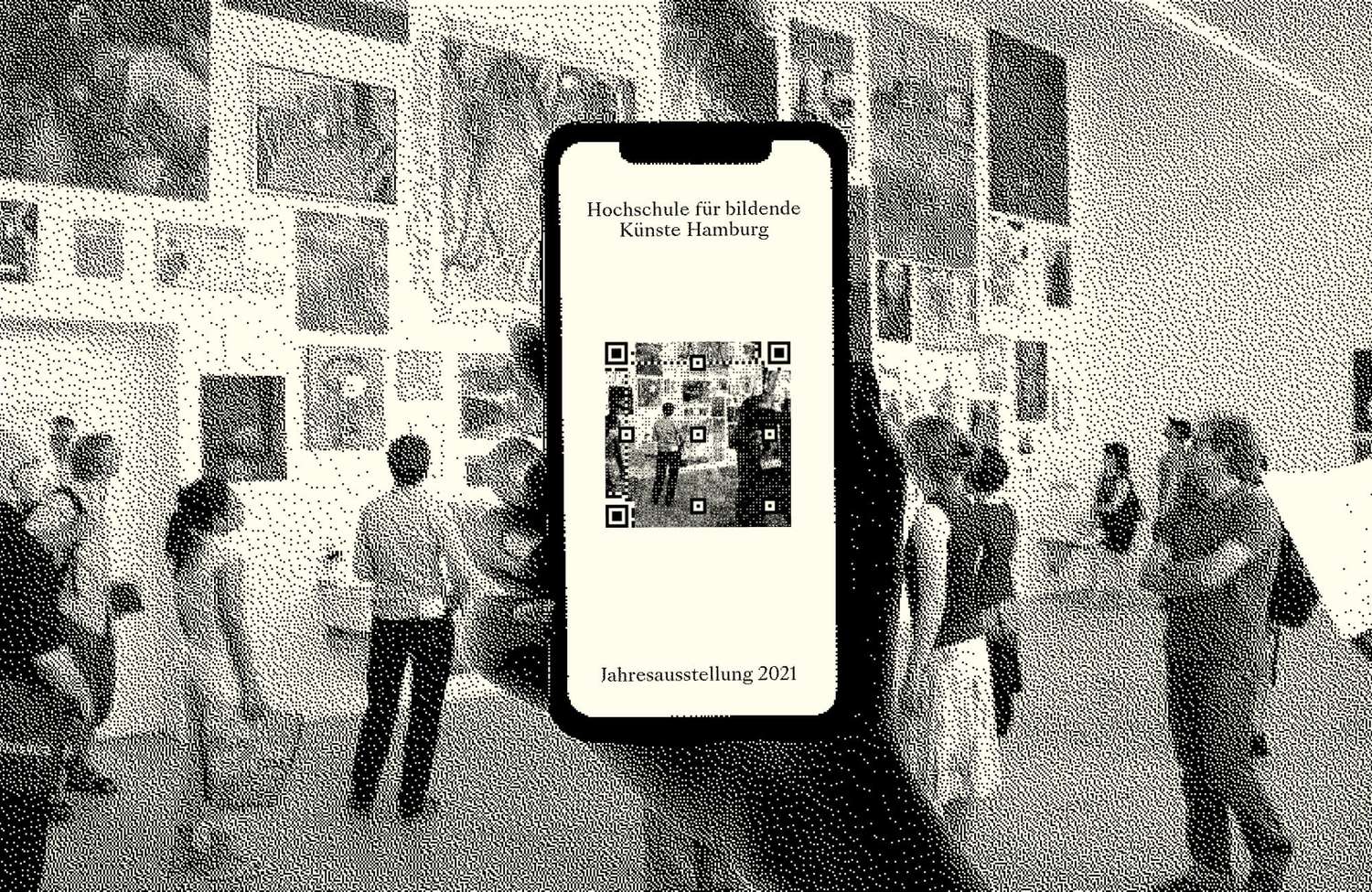

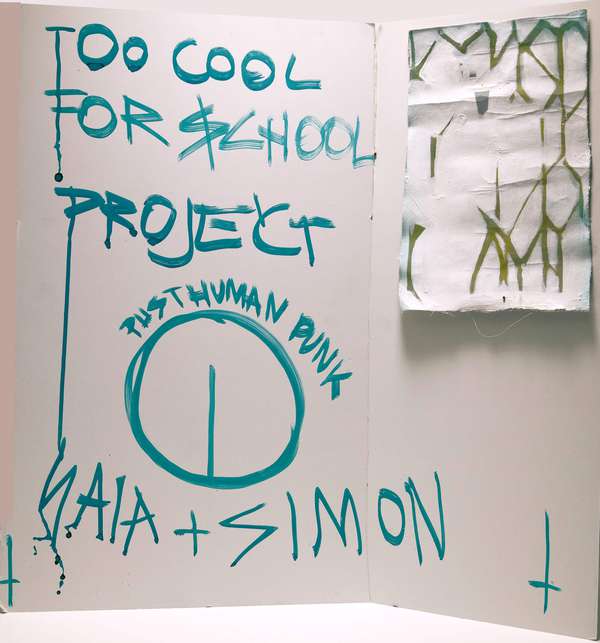

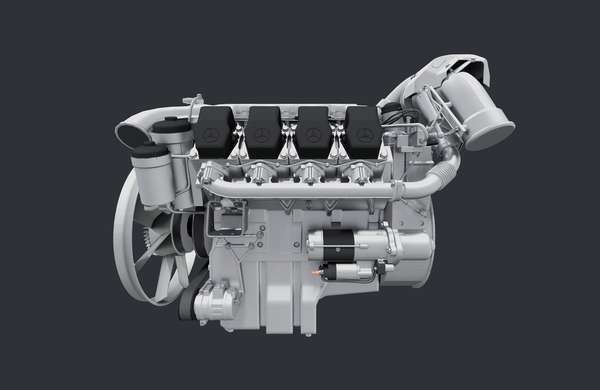





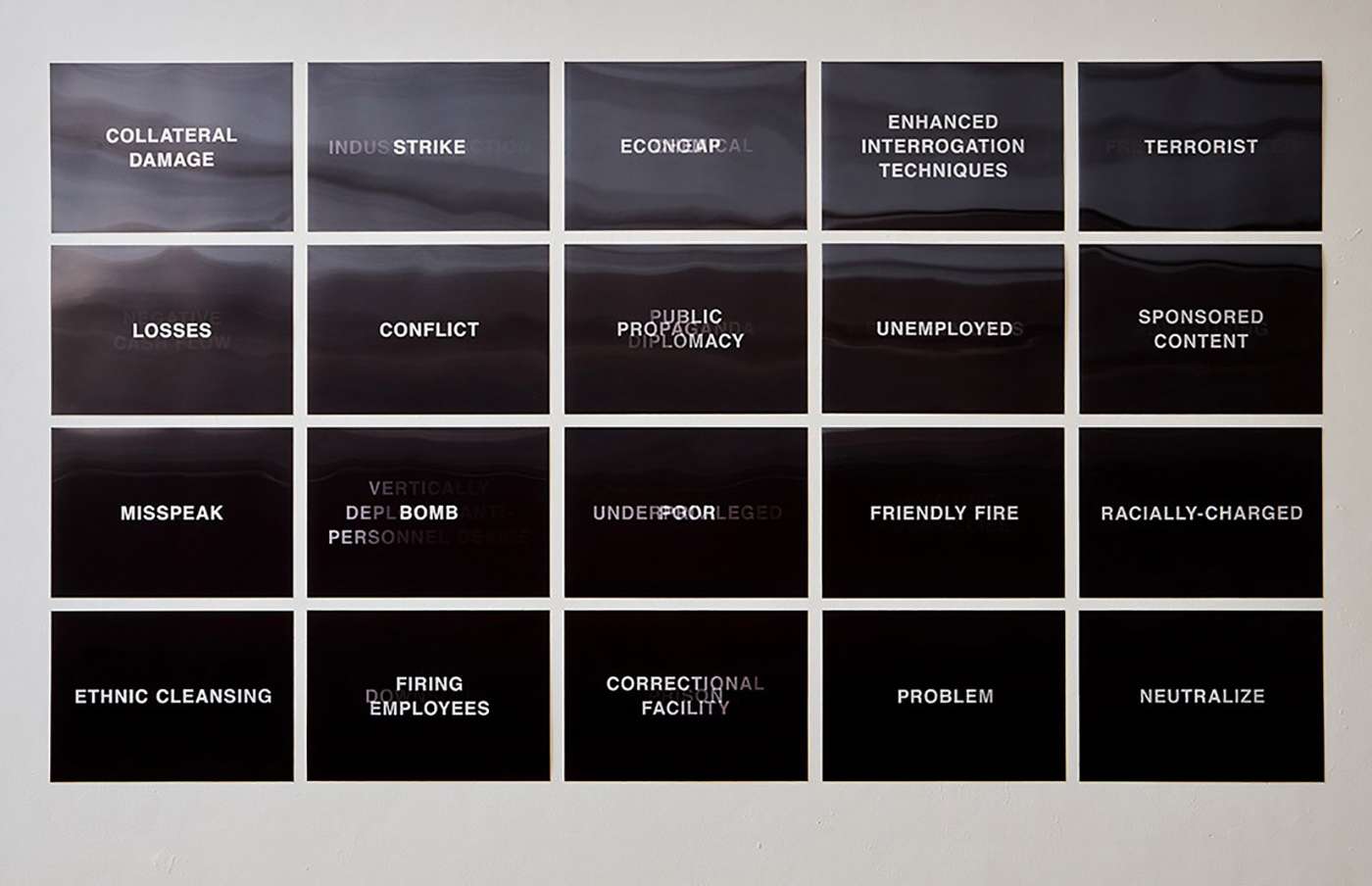




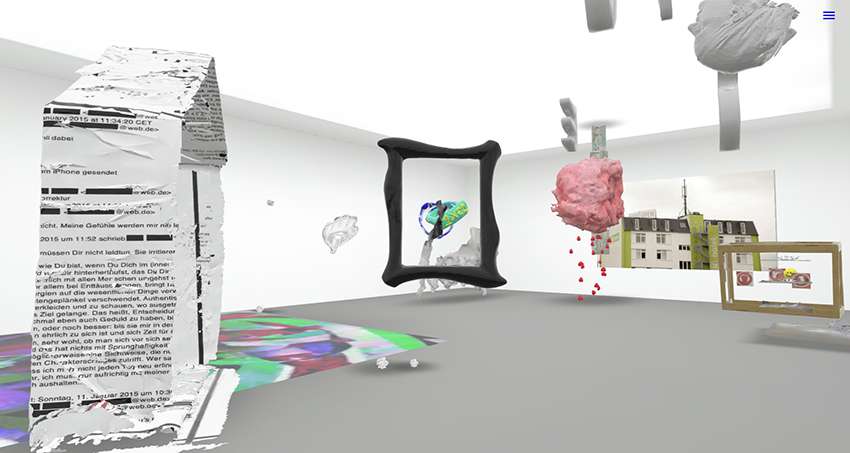
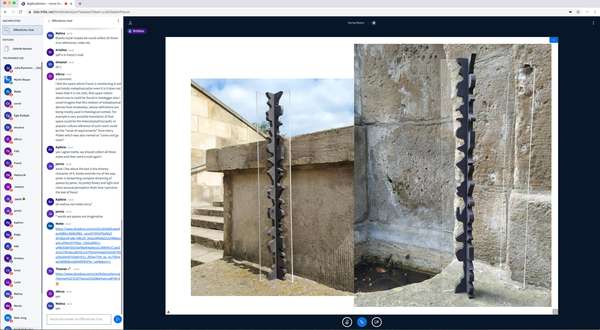
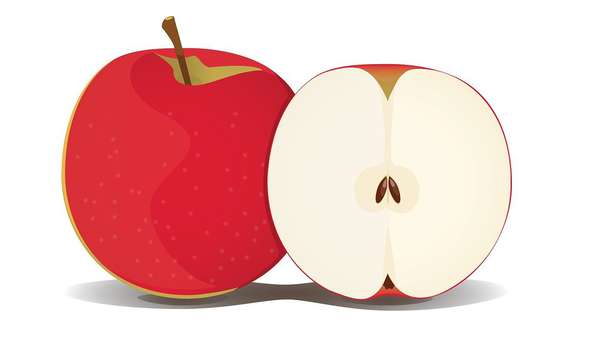

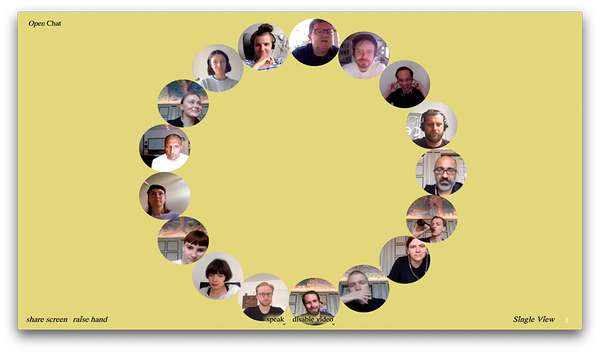
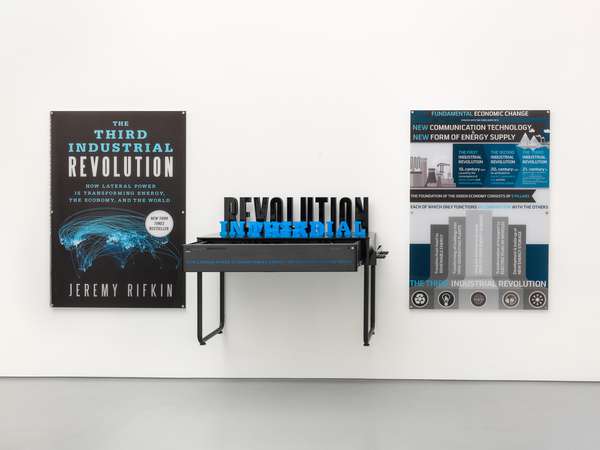











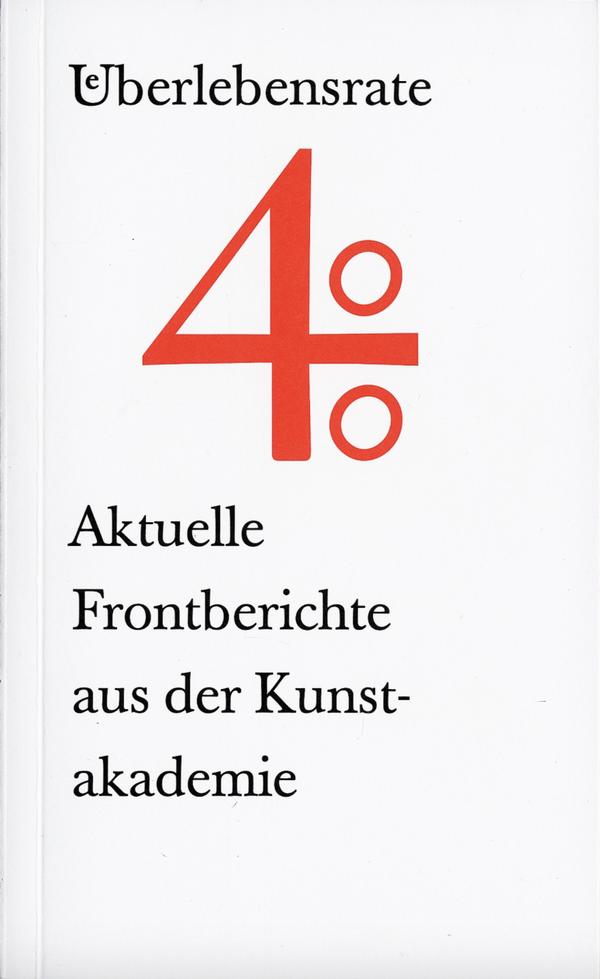


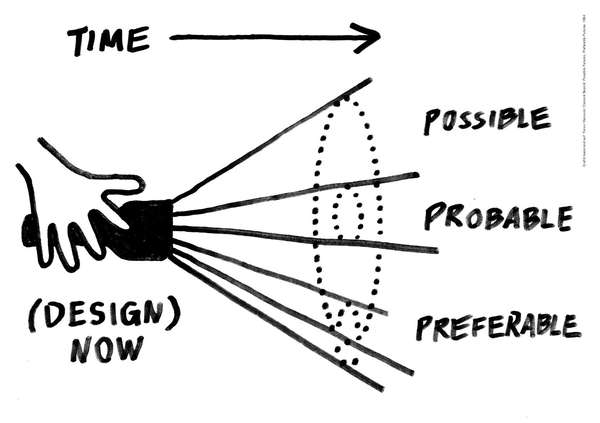
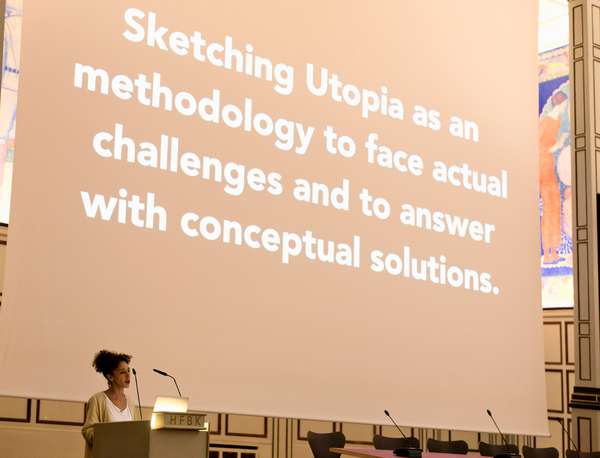
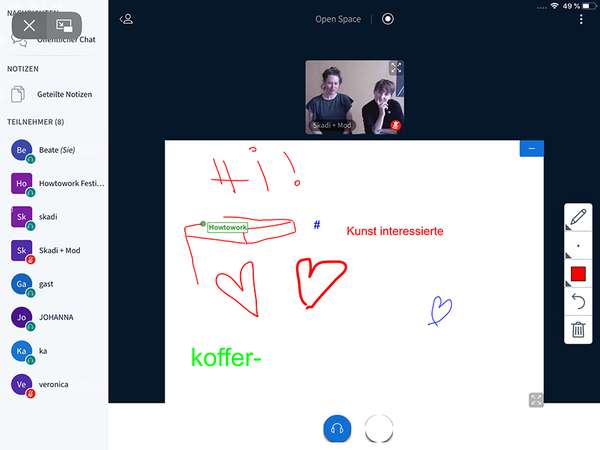

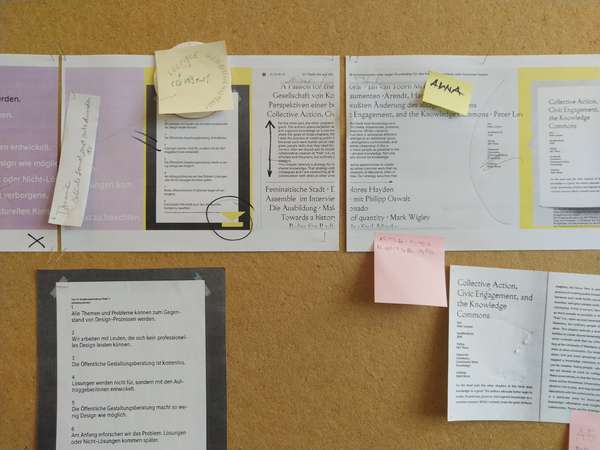
 Graduate Show 2025: Don't stop me now
Graduate Show 2025: Don't stop me now
 Lange Tage, viel Programm
Lange Tage, viel Programm
 Cine*Ami*es
Cine*Ami*es
 Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft
Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft
 Kunst im öffentlichen Raum
Kunst im öffentlichen Raum
 How to apply: Studium an der HFBK Hamburg
How to apply: Studium an der HFBK Hamburg
 Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg
 Der Elefant im Raum – Skulptur heute
Der Elefant im Raum – Skulptur heute
 Hiscox Kunstpreis 2024
Hiscox Kunstpreis 2024
 Die Neue Frau
Die Neue Frau
 Promovieren an der HFBK Hamburg
Promovieren an der HFBK Hamburg
 Graduate Show 2024 - Letting Go
Graduate Show 2024 - Letting Go
 Finkenwerder Kunstpreis 2024
Finkenwerder Kunstpreis 2024
 Archives of the Body - The Body in Archiving
Archives of the Body - The Body in Archiving
 Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa
Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa
 Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg
 (Ex)Changes of / in Art
(Ex)Changes of / in Art
 Extended Libraries
Extended Libraries
 And Still I Rise
And Still I Rise
 Let's talk about language
Let's talk about language
 Graduate Show 2023: Unfinished Business
Graduate Show 2023: Unfinished Business
 Let`s work together
Let`s work together
 Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg
 Symposium: Kontroverse documenta fifteen
Symposium: Kontroverse documenta fifteen
 Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image
Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image
 Einzelausstellung von Konstantin Grcic
Einzelausstellung von Konstantin Grcic
 Kunst und Krieg
Kunst und Krieg
 Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun
Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun
 Der Juni lockt mit Kunst und Theorie
Der Juni lockt mit Kunst und Theorie
 Finkenwerder Kunstpreis 2022
Finkenwerder Kunstpreis 2022
 Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule
Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule
 Raum für die Kunst
Raum für die Kunst
 Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg
 Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments
Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments
 Diversity
Diversity
 Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021
Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021
 Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen
Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen
 Schule der Folgenlosigkeit
Schule der Folgenlosigkeit
 Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg
 Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020
Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020
 Digitale Lehre an der HFBK
Digitale Lehre an der HFBK
 Absolvent*innenstudie der HFBK
Absolvent*innenstudie der HFBK
 Wie politisch ist Social Design?
Wie politisch ist Social Design?